Mailinglists und ihre Strukturen
- Empirische Daten am Beispiel der Mailinglists für Soziologie und Luhmannsche Systemtheorie -
Version 1.0 - August 2000
Martin Rost
Web: http://www.maroki.de/pub/soziologie/mlresearch/mlstudie.html
Inhaltsverzeichnis
- 1 Abstract
- 2.1 Die Anzahl der Mailinglists weltweit
- 2.2 Ein Vergleich mit anderen per Internet zugänglichen Verbreitungsmedien
- 2.3 Die Technik
- 2.4 Das Personal
- 2.5 Die Organisationsformen
- 2.5.1 Die typischen Konflikte
- 2.6 Die datenschutzrechtlichen Aspekte
- 2.7 Das Konfliktmanagement
- 3 Die Bedeutung von Mailinglists für die Wissenschaftsöffentlichkeit
- 3.1 Die Fortsetzung des Projekts der Industrialisierung
- 3.2 Die Industrialisierung der Wissenschaftsorganisationen
- 3.3 Die Schwächen von Mailinglist-Diskursen und deren mögliche Behebung
- 4 Zum Kontext der untersuchten Mailinglists
- 5 Methodische Aspekte der Untersuchung
- 5.1 Die Auswertung des Textarchivs
- 5.1.1 Die Ermittlung des Umfangs der Artikel
- 5.1.2 Die Auswertung der Beiträge
- 5.1.3 Die Auswertung der Themen
- 5.2 Die Auswertung der Mitgliederlisten
- 5.2.1 Die Ermittlung der Gesamtanzahl sämtlicher ML-Mitglieder
- 5.2.2 Die Ermittlung der Anzahl der Autoren
- 5.2.3 Die Ermittlung des Geschlechts
- 5.2.4 Die Ermittlung von Hochschul-Accounts
- 5.3 Der Fragebogen
- 5.3.1 Probleme technisch-operativer Art mit dem Fragebogen auf Seiten der Befragten
- 5.3.2 Probleme technisch-operativer Art seitens des automatischen Auszählens der Fragebögen
- 5.3.3 Methodische Unzulänglichkeiten des Fragebogens
- 5.3.4 Regeln der Auszählung
- 5.3.5 Die Rücklauf- und Beteiligungsquote
- 5.4 Überlegungen zu computergestützten Auswertungen und internetbasierten Umfragen
- 6 Die Auswertung
- 6.1 Die Mitglieder der Mailinglists
- 6.1.1 Das Alter der Mitglieder
- 6.1.2 Der akademische Status der Mitglieder
- 6.1.3 Der Frauenanteil unter den Mitgliedern
- 6.1.4 Von welchem PC aus beobachten die Mitglieder das Geschehen der Listen?
- 6.1.5 Wie wurden die Mitglieder auf die Mailinglists aufmerksam?
- 6.1.6 Warum werden diese Mailinglists subscribiert?
- 6.1.7 Wie ist der Umgang mit den Mailinglists und wie wird deren Bedeutung für
den wissenschaftlichen Diskurs taxiert? - 6.1.8 Welche Bedeutung schreiben die Mitglieder den Mailinglist-Debatten zu?
- 6.1.9 Wie beurteilen die Mitglieder das Geschehen in den Mailinglists?
- 6.2 Die Autoren
- 6.3 Die Artikel
- 7 Kennzeichen einer gut funktionierenden Mailinglist
- 9 Anhang
- 9.1 Anhang: Der Fragebogen
- 9.2 Die Ergebnisstabellen im einzelnen
- 9.3 Kommentare zur Mailinglist bzw. zur Untersuchung
- 9.3.1 Frei zum Fragebogen hinzugefügte Kommentare von Teilnehmern der ML-Soziologie
- 9.3.2 Frei zum Fragebogen hinzugefügte Kommentare von Teilnehmern der ML-Luhmann
- 9.3.3 Kommentare, die am Support-Account von Teilnehmern der ML-Soziologie eintrafen
- 9.3.4 Kommentare, die am Support-Account von Teilnehmern der ML-Luhmann eintrafen
- 9.4 Die Erinnerungs-Mail
- 9.5 Anweisungen für das tda-Statistikprogramm
- 10 Dank
1 Abstract
Diese Studie legt eine Bestandsaufnahme der Mailinglist für Soziologie und der Mailinglist für Luhmannsche Systemtheorie vor. Als Quellen standen archivierte Beiträge, monatlich erhobene Mitgliederlisten sowie Daten einer per E-Mail durchgeführten Mitgliederbefragung zur Verfügung. Im theoretischen Teil werden die Organisationsformen von Mailinglists systematisiert, einige rechtliche Aspekte der Einordnung von Mailinglists als Medien- oder Teledienst erörtert sowie die Folgen, Funktionen und neue Möglichkeiten elektronisch gestützter Kommunikationsforen für den wissenschaftlichen Diskurs diskutiert.
2 Was ist eine Mailinglist?
- 2.1 Die Anzahl der Mailinglists weltweit
- 2.2 Ein Vergleich mit anderen per Internet zugänglichen Verbreitungsmedien
- 2.3 Die Technik
- 2.4 Das Personal
- 2.5 Die Organisationsformen
- 2.5.1 Die typischen Konflikte
- 2.6 Die datenschutzrechtlichen Aspekte
- 2.7 Das Konfliktmanagement
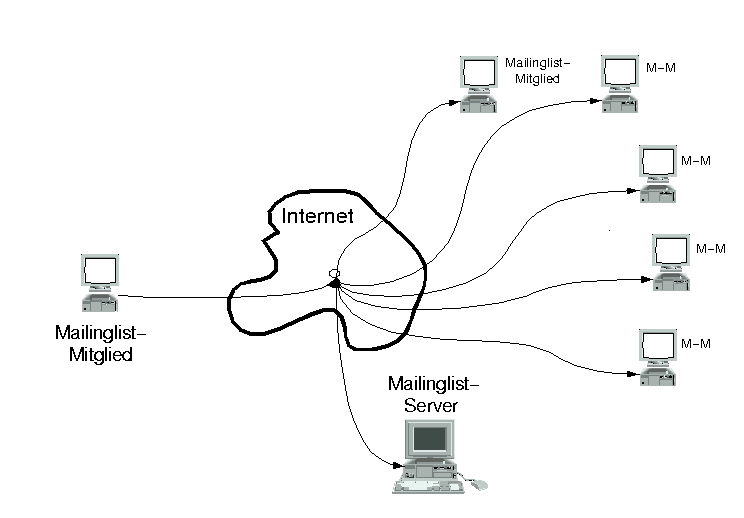
Die technische Kernfunktion einer Mailinglist besteht darin, eine E-Mail in Kopie an sämtliche E-Mailadressen, die in einer Adressliste verzeichnet sind, weiterzuleiten. Damit ein Interessent an einer Mailinglist teilnehmen kann, muss sich dieser entweder in die Adressliste, dies ist die Mailinglist im engeren Sinne, einschreiben oder jemand anderes, typischerweise der Verwalter der Mailinglist ("Listowner"), ist berechtigt, E-Mailadressen in die Mailinglist einzutragen.(Endnote 1) Damit eine E-Mail an sämtliche Mitglieder der Mailinglist weitergeleitet wird, schickt der Autor oder die Autorin diese an die Adresse der Mailinglist.(Endnote 2)
Mailinglists werden ganz überwiegend sowohl für offen zugängliche als auch für geschlossen-interne Kommunikationen innerhalb einer Gruppe bzw. Organisation genutzt. Während bei offen zugänglichen Mailinglists der Zweck durch Vorgabe eines mehr oder weniger enggeschnittenen Themas ausgewiesen ist, zeichnen sich interne Mailinglists oftmals dadurch aus, dass ihr Zweck darin besteht, ohne thematische Festlegung einfach die Möglichkeiten elektronisch gestützter Kommunikationen für die spezifischen Belange einer Gruppe bzw. Organisation nutzbar zu machen, insbesondere in einer heterogenen Netzinfrastuktur. Dessen eingedenk läßt sich eine Mailinglist wie folgt definieren:
Definition 1: Eine Mailinglist bezeichnet ein Verbreitungsmedium zur Verteilung von E-Mails innerhalb einer endlichen Menge an E-Mailadressen zu einem ausgewiesenen Thema oder Zweck.
Der problematischste Aspekt dieser Definition, die weiter unten noch um Aspekte der Unterscheidung von Mailinglists untereinander ergänzt werden wird, besteht darin, dass von der endlichen Menge an E-Mailadressen nicht auf ein klar definiertes Set an Empfängern rückgeschlossen werden kann bzw. sollte.(Endnote 3) Während sich bei gruppen- bzw. organisationsinternen Mailinglists der Empfängerkreis anhand überprüfbarer Zuordnungen von E-Mailadressen und Personen in der Regel umstandslos ermitteln läßt, ist dies bei offen zugänglichen Mailinglists nicht ohne weitere Anstrengungen möglich. Ganz abgesehen von der immer gegebenen Möglichkeit, dass Mailinglistbeiträge offen zugänglicher Mailinglists an Nichtmitglieder (durchaus automatisiert) weitergeleitet werden können, kann sich hinter jeder E-Mailadresse eine weitere Mailinglist bzw. eine E-Mailadresse einer Organisation verbergen, die zentral eintreffende E-Mails an ihre Mitglieder intern weiter verteilt, ohne dies dem Mailinglistbetreiber gegenüber offenzulegen. Selbst wenn in einer Mailinglist ein typischer Vorname Bestandteil einer E-Mailadresse sein sollte, so kann es sich dabei trotzdem um einen Automaten handeln, der E-Mails zu verschicken bzw. auf E-Mails differenziert zu reagieren in der Lage ist.(Endnote 4)
Allgemeiner betrachtet ist die Zurechnung von Kommunikationen auf Personen (oder Organisationen) in einem elektronisch zugänglichen Verbreitungsmedium grundsätzlich fragwürdig, denn neben Personen sind auch (Teile von) Organisation und sogar Maschinen adressierbar. Etwaige Reichweitenabschätzungen, insbesondere bei offen zugänglichen Mailinglists, sollten insofern nicht allzu kurzschlüssig erfolgen.
Diese für Mailinglists typische Art der Unwägbarkeit bei der Abschätzung des Adressatenkreises gilt in einem weitaus stärkeren Maße auch für andere "Verbreitungsmedien" (vgl. Luhmann 1997) wie Bücher, Zeitschriften und Zeitungen sowie Fernseh- und Radiosendungen. Im Unterschied zu diesen lassen sich bei Mailinglists die Empfänger jedoch im Prinzip mit der Bitte anschreiben, mitzuteilen, in welchem Umfang sie Beiträge aus einer Mailinglist weiterleiten und ob sie Automaten seien oder nicht. Und im Vergleich zu anderen elektronisch zugänglichen Foren wie Newsgroups, Chats und Webforen ist es bei Mailinglists zudem bedeutend leichter, den Adressatenkreis für derartige Nachfragen zu bestimmen. Insofern bestehen bei offen zugänglichen Mailinglists vergleichsweise die besten Chancen, den Adressatenkreis der Empfänger (bzw. potentiellen Sender) von Beiträgen zu bestimmen, weshalb ich die obige Definition auch bei offen zugänglichen Mailinglists für im Ganzen noch gerechtfertigt halte.
2.1 Die Anzahl der Mailinglists weltweit
Wollte man die Zahl an Mailinglists abschätzen, so liesse sich dies nicht sinnvoll durchführen, allein deshalb, weil sich interne Mailinglists spontan bei Bedarf ebenso schnell gründen wie wieder abreißen lassen. Selbst grobe Ansprüche an den Erhalt eines Überblicks sind nicht erfüllbar, weil man davon ausgehen muss, dass wenn nicht heute, so doch in nächster Zeit absehbar jede Organisation über einen allgemein-organisationsweiten sowie einen spezifisch-abteilungsweiten Newsletter auf Mailinglistbasis verfügt.(Endnote 5)
Und auch das Themenangebot offen zugänglicher Mailinglists ist unüberschaubar, selbst wenn man das Angebot von Mailinglist-Katalogen wie beispielsweise liszt, lisde oder meta-list und selbstverständlich guten Web-Suchmaschinen wie beispielsweise Metacrawler, MetaGer, MetaSpinner oder Google nutzt.
2.2 Ein Vergleich mit anderen per Internet zugänglichen Verbreitungsmedien
Gegenüber anderen ebenfalls per Internet zugänglichen Foren wie Newsgroups, Chats oder Webforen, weisen Mailinglists, im Hinblick insbesondere auf wissenschaftlich orientierte Diskurse, denen nachfolgend die Konzentration gilt, Eigenschaften auf, die zwecks weiterer Konturenschärfungen kurz angesprochen werden sollen:
Öffentliche Newsgroups sind, im Unterschied zu Mailinglists, auch für thematisch nicht instruierte Nutzer spontan zugänglich. Dieser Vorteil, der sich insbesondere in der Unkontrollierbarket des Mitteilungsflusses auszeichnet, ist zugleich ein Nachteil, weil nur wenige schlechte Beiträge von thematisch ungebundenen Spontannutzern ausreichen, um eine Newsgroup auf lange Zeit für engagiert-gehaltvolle Debatten zu entwerten.(Endnote 6) Bei offen zugänglichen Mailinglists werden thematisch ungebundene Destruktivbeiträge dadurch unwahrscheinlicher gemacht, dass Teilnehmer sich vor ihrer Teilnahme in die Mailinglist einschreiben müssen.
Die Nutzung von Chats ist, anders als die von Mailinglists und Newsgroups, synchron an Zeit und an die Nutzung des gleichen Internet-Relay-Chat-Servers gebunden. Der Vorteil von Chats, nämlich dialogisch verfaßt zu sein, so dass ein Gefühl der Nähe, der Verbundenheit und der Verantwortung für das Gelingen der Kommunikation unter den Teilnehmern entstehen könnte, ist zugleich ein Nachteil, weil sich komplexere Argumentfolgen nicht in Sekunden entwickeln lassen. Die Abfolge der meist nur wenige Sätze umfassenden Beiträge in den Chatrooms ist dafür zu nervös. Wer in Chat-Debatten hinreichend extrovertiert auftritt und schlicht schneller schreiben kann "gewinnt". Chats können sinnvoll eingesetzt werden, wenn die Regularien innerhalb einer festumrissenen Teilnehmergruppe nicht erst ausgehandelt werden müssen und es darum geht, entweder schnell brennende Fragen zu klären, sofern prinzipielle Übereinstimmung besteht oder um kontroverse Standpunkte voneinander abzugrenzen. Sie bedürfen dann aber in jedem Fall einer Ausarbeitung und Aufbereitung.(Endnote 7)
In offen zugänglichen Webforen hat man ebenso mit spontan geschriebenen Beiträgen zu rechnen, deren Teilnehmer sich nicht in jedem Falle durch Kenntnisreichtum auszeichnen möchten. Deshalb schränken viele Betreiber von Webforen entweder durch die Aufforderung zum Registrieren den Nutzerkreis ein oder sie betreuen ihre Webforen redaktionell. Mag Registrieren oder eine redaktionelle Betreuung zum Erreichen eines erwartbaren Niveaus auf den ersten Blick auch für engagierte Nutzer attraktiv erscheinen, so nehmen sich die meisten Webforum-Betreiber dadurch das Recht, die aus ihrer Sicht unangemessenen Beiträge bzw. die Adressen der Nutzer umstandslos zu löschen. Die Mitglieder bzw. Teilnehmer solcher Foren müssen sich deshalb mit Teilnahmebedingungen einverstanden erklären, wonach jeder in diesem Forum geschriebene Beitrag den Forumbetreibern zufällt. Dadurch wird die klassisch Form der Herstellung von Öffentlichkeit auch im neuen Medium reproduziert - ein Umstand, der insbesondere erfahrenen Netznutzern aus der Frühzeit der Netznutzung als unangemessen aufstößt. Und es sind denn auch exakt die Betreiber klassischer Publikationsmedien, die sich bevorzugt solcher Webforen bedienen.(Endnote 8)
Desweiteren kommt als Nachteil hinzu, dass Teilnehmer ein Web-Forum aktiv anwählen (und unter Umständen einige Kosten dafür in Kauf nehmen) müssen. Die strategischen Überlegungen von Webforen-Betreiber zielen deshalb darauf, insbesondere durch permanent neue Meldungen eine Nutzerbindung zu erzielen, so dass Neueinsteiger durchaus auch ohne konkreten Anlaß motiviert sein könnten, das Forum aufsuchen. Die Existenz einer Mailinglist bringt sich dagegen zwangsläufig mit jedem Beitrag erneut ins Gedächtnis. Das Web ist deshalb vornehmlich zur ersten Kontaktaufnahme zwischen Institutionen und deren Nutzer, zur Bereitstellung von standardisierten Datenbankzugriffen sowie für die Publikation von als abgeschlossen deklarierten Dokumenten (darin können auch Audio- und Videodaten eingeschlossen sein) geeignet.
Im Vergleich mit den so überaus komfortabel zugänglichen Webpublikationen werden die Möglichkeiten von Mailinglists in der Regel unterschätzt, vermutlich deshalb, weil die Leistungsfähigkeit von Mailinglists zunächst nicht so sinnfällig erbracht wird und sie nur einen schlichten Mailzugang, der durchaus von einer als Hobby betriebenen Mailbox in einem Entwicklungsland gestellt werden kann, voraussetzen. Dass sich Mailinglists, im Unterschied zum Web, als Pushmedium besonders gut eignen, scheinen inzwischen jedoch immer mehr Institutionen zu bemerken. Deshalb gehen sie dazu über, "Kundenbindung" sowohl über Selbstdarstellungen im Web als auch über Newsletter auf der Basis von Mailinglisttechnik herzustellen.
Mailinglists spielen überall dort eine zunehmend wichtigere Rolle, wo mehrere Menschen ohnehin miteinander im Austausch per E-Mail stehen. Mailinglists einzurichten empfiehlt sich immer dann, wenn es gilt,
- eine kostengünstige, weltweit schnelle Versorgung mit
aktuellen Mitteilungen einzurichten,
- und/ oder eine möglichst effiziente Form der Zusammenarbeit
in technisch und organisatorisch heterogenen Umgebungen zu finden, die
außer präziser Adressierbarkeit keine festeren Kopplungen
durch eine spezifisch zugeschnittene Groupware-Applikationen
gestatten,
- und/ oder für faire Chancen auf Teilnahme an Diskussionen zu
sorgen.
2.3 Die Technik
Die Grundfunktion einer Mailinglist, E-Mail in Kopie an mehrere Empfänger zeitnah und nahezu gleichzeitig zu verteilen, kann ohne besonderen technischen Aufwand mit jedem modernen E-Mailprogramm realisiert werden, indem beispielsweise die E-Mailadressen der Gruppenmitglieder über eine einzige symbolische E-Mailadresse ("Alias") angesprochen werden. Wenn der Empfänger einer solchen E-Mail dann mit einem Befehl wie "Gruppenantwort" (Englisch: "group-reply") antwortet, wird diese Antwortmail wiederum an sämtliche Mitglieder geschickt. Richtet ein jedes Gruppenmitglied einen solchen Alias, hinter dem sämtliche E-Mailadressen der Gruppenmitglieder aufgezählt sind, bei sich ein, ist die Kernfunktion einer Mailinglist nachgebildet. Für kleine, geschlossene Benutzergruppen und für kleine Projekte kann ein solches Verfahren durchaus ausreichen.
Unter einem Unix-System würde man eine derart einfache Mailverteilungsfunktion über Adresseinträge in die /etc/aliases- oder als eine Datei (typischerweise .forward genannt) eines eigens dafür eingerichteten Pseudonutzers realisieren. Mails, die bei einem solchen Adresseintrag bzw. Nutzer eintreffen, werden dann automatisch an sämtliche dort eingetragenen E-Mailadressen weitergeleitet. Allerdings bietet diese Lösung wie auch die zuvor geschilderte wenig Komfort.
Mailinglists mit großem Mitglieder- und Beitragsaufkommen werden sinnvollerweise mit speziellen Mailinglistserver-Programmen abgewickelt. Als Beispiele für Mailinglistserver-Programme sind der listserv, majordomo(Endnote 9) und listproc als traditionell viel eingesetzte Programme sowie der petitdomo, smartlist und rnalib als kleinere Programme zu nennen. Generell machen diese Programme den Umgang mit Mailinglists für Anwender und Betreiber komfortabler und gestatten vor allem die Realisierung verschiedener Organisationsformen. So schätzen Betreiber von Mailinglists die Automatisierung des Betriebsablaufs und die Anwender die Zugänglichkeit eines Archivs sowie statistischer Kennzahlen oder die Möglichkeit zur Einrichtung einer Digestfunktion(Endnote 10) . Komplexere Mailinglistssoftware der neuesten Generation, wie etwa MailMan oder EZMLM, zeichnet sich für Betreiber insbesondere durch einen intelligenten Umgang mit solchen Adressierungen aus, die Fehler erzeugen.
2.4 Das Personal
Am Gelingen einer Mailinglist als Kommunikationsform sind unterschiedliche Personengruppen beteiligt, die üblicherweise in "Betreiber" und "Anwender" unterschieden werden. Eine solch grobe Differenzierung reicht für die vorliegende Untersuchung nicht aus. Zur Bezeichnung des Personals, das für das Funktionieren von Mailinglists Voraussetzung ist und zugleich die gestiegene Komplexität der Organisationen, die Mailinglist betreiben, anzeigen, sind zumindest die folgenden Unterscheidungen zu treffen:
- Der Besitzer unterhält die unmittelbare technische
und organisatorische Infrastruktur (Computer, Netzzugang), auf der die
Mailinglist als technische und organisatorische Einheit aufsetzt.
Hiernach wären beispielsweise die Internet-Service-Provider, die Mailinglists auf den Wunsch ihrer Kunden aufsetzen, die Besitzer dieser Mailinglists.
- Der System-Administrator, meist kurz als Sysadmin
bezeichnet, installiert, konfiguriert und betreut die technische
Infrastruktur, zu der auch das Mailinglist-Server-Programm
gehört.
In dieser Form von einem System-Administrator zu sprechen, reicht für die Diskussion der hier aufgeworfeen Problemstellungen aus. In einigen großen Organisationen mit einem großem Rechnerpark trifft man auf feinere Unterteilungen: Dort gibt es System-Adminstratoren, die allein für den Betrieb der Hardware zuständig sind, während andere Sysadmins sich ausschließlich mit dem Betriebssystem oder mit der Verwaltung des internen oder mit dem per Internet erreichbaren Teil des eigenen Netzes beschäftigen.
- Der Listowner gewährleistet das Funktionieren der
Mailinglist auf organisatorischer Ebene. Er verwaltet die
Einträge der Mitglieder, konfiguriert die
Kommunikationseinstellungen des Mailinglist-Servers und gibt
Hilfestellungen. Vor allem obliegt ihm die Kontrolle der
Organisationsform einer Mailinglist. Unter dem Listowner wird deshalb
üblicherweise der "organisatorische Besitzer" einer
Mailinglist verstanden.
Wenn keine hohen Ansprüche an die Nutzerbetreuung gestellt werden, weil die Erwartungen gering und die Kompetenzen der Beteiligten hinreichend ausgebildet sind, dann läßt sich die Funktion eines Mailinglistowners, zumindest bei viel genutzten, offen zugänglichen Mailinglists, bei denen die Anwender keine hohen Betreuungsaufwand stellen, vollständig automatisieren. Aus diesem Grunde gewinnt eine weitere Subunterscheidung in eine manuelle- und eine vollautomatische "Mitglieder-Betreuung" zunehmend an Bedeutung.(Endnote 11) Desweiteren beschäftigen Betreiber einer Vielzahl von mitgliederstarken Mailinglists neben dem Listowner, der für eine einzige Mailinglist zuständig ist, oftmals auch noch Listmaster, die für die Wartung des gesamten Mailinglist-Systems und die Betreuung der Listowner zuständig sind. So verfährt zum Beispiel die GMD (Forschungszentrum Informationstechnik GmbH, Sankt Augustin bei Bonn), die im Auftrag des Deutschen Forschungsnetzes (DFN) eine derart nach Technik und Organisation geschiedene Infrastruktur für den Betrieb wissenschaftlicher Mailinglists unterhält.
- In moderierten Mailinglists begutachten Moderatoren vor
dem Weiterleiten die Qualität von Beiträgen und schicken
gegebenenfalls die als schlecht bewerteten Beiträge an die
Autoren mit der Aufforderung zur Überarbeitung zurück. Stark
beanspruchte Moderatoren gehen dazu über, Redaktionsstäbe
einzurichten, um die Arbeit besser zu bewältigen.
- Die Mitglieder einer Mailinglist haben sich in die
Mailinglist eingeschrieben und empfangen die Diskussionsbeiträge,
die über die Mailinglist verteilt werden.
- Als Teilnehmer einer Mailinglist bezeichne ich dagegen
solche Mitglieder, die mit eigenen Beiträgen an Diskussionen
aktiv teilnehmen.
Der Besitzer, System-Administrator und Listowner werden zumeist als Mailinglist-Betreiber bezeichnet, insbesondere wenn eine Mailinglist privat von einer einzelnen Person, die diese Funktionen ohnehin ungeschieden übernimmt, betrieben wird. Die explizite Differenzierung dieser Funktionen ist deshalb ein Indikator für die Professionalisierung der Mailinglistorganisation. Die Mitglieder und Teilnehmer werden zusammengefaßt als Anwender, Mailinglist-Nutzer oder User bezeichnet. Die Organisationsform einer Mailinglist, die im nachfolgenden Kapitel thematisiert wird, setzt diese Personen in verschiedene Machtverhältnisse zueinander.
2.5 Die Organisationsformen
Die Organisationsform einer Mailinglist ist das Ergebnis dreier Konditionierungen, nämlich unter welchen Bedingungen a) aus Interessenten Mitglieder einer Mailinglist werden können (Zugangsberechtigung), b) Mitgliedern die Publikation von Beiträgen gewährt wird (Publikationsberechtigung), c) die Beiträge von Mitgliedern einer Begutachtung unterliegen oder nicht (Bewertungsberechtigung). Anhand dieser drei Kriterien lassen sich die Organisationsformen von Mailinglists unterscheiden bzw. von dem Listowner einer Mailinglist aufsetzen:
- Zugangsberechtigung: offen oder geschlossen
Bei einer offen zugänglichen Mailinglist kann sich jeder über E-Mail verfügende Interessent anhand einer Anmeldungs-E-Mail als Mitglied der Mailinglist automatisch eintragen lassen. Der Interessent an einer offen zugänglichen Mailinglist unterliegt somit keiner Begutachtung, bevor er Mitglied werden darf.
Der Interessent an einer geschlossen betriebenen Mailinglist muss dagegen einen Antrag auf Mitgliedschaft stellen und wird dann, sofern dem Antrag meist durch den Mailinglistowner stattgegeben wird, von Hand in die Mailinglist eingetragen.(Endnote 12)
- Publikationsberechtigung: allseitig, mehrseitig oder
einseitig.
Mailinglists lassen sich mit verschiedenen Publikationsrechten für die Mitglieder einrichten:
- Bei einer allseitig eingeräumten
Publikationsberechtigung werden die Beiträge der Mitglieder
vorbehaltslos verteilt. Dieser Verteilmodus wird
"all-to-all" genannt.
- Bei einer mehrseitig ausgerichteten
Publikationsberechtigung wird allen Mitgliedern zwar die
Leseberechtigung, aber nur einer Auswahl an Mitgliedern ein
Publikationsrecht eingeräumt (Verteilmodus:
"many-to-all"). Allerdings ist eine solche Konstellation
ungewöhnlich. Anstatt eine Gruppe innerhalb einer Mailinglist
abzubilden, werden oftmals zwei allseitige Mailinglists eingerichtet:
eine offen zugängliche, mit allseitigem Publikationsrecht und
eine geschlossene Mailinglist, mit allseitigem Publikationsrecht
für den inner circle der Mailinglist-Mitglieder.
- Bei einer einseitigen Publikationsberechtigung
dürfen alle Mitglieder die Beiträge lesen, aber nur eine
einzige Instanz, typischerweise der Mailinglistowner bzw.
Mailinglistbetreiber, darf publizieren (Verteilmodus:
"one-to-all").
- Bei einer allseitig eingeräumten
Publikationsberechtigung werden die Beiträge der Mitglieder
vorbehaltslos verteilt. Dieser Verteilmodus wird
"all-to-all" genannt.
- Bewertungsberechtigung: moderiert/ unmoderiert,
member-scored.
In einer moderierten Mailinglist gelangen die Beiträge der Teilnehmer zunächst an einen Moderator, der die Beiträge sichtet und der die seiner Ansicht nach schlechten Beiträge an die Autoren mit der Aufforderung zur Überarbeitung zurückschickt. Die Moderatorfunktion kann von einer Redaktion übernommen werden. In einer nicht-moderierten Mailinglist gelangen sämtliche Beiträge, ohne dass ein redaktioneller Filter dazwischengeschaltet ist, an die Mitglieder.
Moderatoren werden oftmals dann eingerichtet, wenn bei offen-zugänglichen Mailinglists mit allseitigem Mitteilungsfluß, hoher Mitgliederanzahl und hohem Aufkommen an Beiträgen, die Qualität der Beiträge in einem beträchtlichen Maße schwankt und kommunikativ-destruktive Diskursteilnehmer die thematische Ausrichtung und das Niveau einer Mailinglist gefährden.
Bislang noch ohne wirklich praktische Bedeutung sind solche Mailinglists, in denen die Mitglieder selber formalisierte Bewertungen ("Scorings") zu den Mailinglistbeiträgen abgeben. Weil diese demokratietheoretisch wünschenswerten Verfahren, die bislang nur als Ideen oder Konzeptstudien realisiert wurden, der Niveauregulierung dem Medium meiner Ansicht optimal angemessen sind, sollten sie zumindest auch an diesem Punkt der Diskussion bereits erwähnt werden.
Die folgenden vier Konstellationen von Personal und Organisationsform sind für Mailinglists derzeit typisch:
Spontan zustandegekommene Arbeitskreise, Strategie- oder Entwicklergruppen bevorzugen typischerweise geschlossene und allseitige Mailinglists ohne eine zentrale Bewertungsinstanz, in der arbeitsteilig, unter Wertschätzung der speziellen Kompetenzen der Beteiligten, zusammengearbeitet wird. Das Niveau und die Anzahl der Beiträge lassen sich informell regeln. Bei Bedarf können darüberhinaus weitere, gerade auch externe Mitarbeiter in die Mailinglist aufgenommen werden, weil weder die Verwendung eines bestimmten Betriebssystem noch eines Formats einer bestimmten Textverarbeitung, Tabellenkalkulation oder Datenbank Voraussetzung sind.(Endnote 13) Derartig organisierte Mailinglists liessen sich übergreifend als Projektmailinglists bezeichnen.
Bei den wissenschaftlich orientierten Mailinglists findet man ein breites Spektrum an Organisationsformen. Eine kleine Expertengruppe, die vielleicht gemeinsam an einer Publikation arbeitet, wird ebenso wie eine international kooperierende Forschungsgruppe, eine geschlossene, allseitige und unmoderierte Liste bevorzugen. Mailinglists, die parallel zu einer klassischen Papierpublikation, etwa einer Zeitschrift, betrieben werden, bevorzugen eine geschlossene, allseitige aber oftmals auch moderierte Form der Kommunikation oder eine mehrseitige und bewertete Form, die im Grunde einer traditionellen redaktionellen Moderation gleichkommt. Da die Orientierung am Diskurs für die wissenschaftliche Wahrheitskonstitution essentiell ist, operieren jedoch eine ganze Reihe an wissenschaftlichen Mailinglists offen-zugänglich, allseitig und unbewertet und kompensieren dadurch die Schwächen papierener Medien im Hinblick auf die tatsächliche Führbarkeit von Diskursen. Letztere Mailinglists, denen auch die hier untersuchten Mailinglists zuzuzählen sind, wären als Diskursforen im engeren Sinn zu bezeichnen.
Mailinglists, die für spezielle Fragestellungen von öffentlichem Interesse eingerichtet wurden, und an denen typischerweise in großer Zahl sowohl Laien als auch Experten teilnehmen - als typische Beispiele denke man an medizinische Mailinglists -, bevorzugen offen zugängliche, häufig allseitige und in der Regel moderierte Mailinglists.(Endnote 14) Solche Mailinglists lassen sich als Podiumsdiskussionsforen bezeichnen.
Inzwischen haben auch Unternehmen und die ersten Verwaltungen den Nutzen von Mailinglists entdeckt. Viele große Unternehmen, insbesondere aus dem Bereich der Netztechnik, versorgen ihre Interessenten und Kunden heute per Mailinglist mit aktuellen Mitteilungen.(Endnote 15) Firmen bevorzugen je nach Aufgabenstellung dafür entweder geschlossene (für den oftmals obendrein kostenpflichtigen Kundensupport) oder offen-zugängliche (für Firmen- oder Produktwerbung) Mailinglists, die fast alle einseitig ausgelegt sind. Kommerziell betriebene Mailinglists werden generell geschlossen und einseitig ausgelegt, deren Interessenten erst dann auf die Mailinglist gesetzt werden, nachdem sie dafür bezahlt haben. Dies ist häufiger bei solchen Mailinglists der Fall, bei denen exklusive und somit weiterverkaufbare Meldungen eingespeist werden. Bei einseitigen Mailinglists, die allein der Verlautbarung des Mailinglist-Betreibers dienen, können keine kritischen Diskussionen, die möglicherweise under cover durch Konkurrenten initiiert wurden, unkontrolliert aufbranden. Die meisten geschlossen und einseitig eingerichteten Mailinglists entsprechen insofern klassischen Presseverteilern, die zumeist als Newsletter bezeichnet werden. Offen zugängliche, einseitige Mailinglists entsprechen dagegen eher Hausmitteilungen oder Werbebroschüren.
Die bereits oben angeführte allgemeine Definition einer Mailinglist kann nach dem bisher Gesagten wie folgt so spezifiziert werden, dass Mailinglists auch untereinander unterscheidbar werden:
Definition 2: Mailinglists lassen sich untereinander unterscheiden anhand
- des Grades der Differenzierung des Personals (Besitzer,
Systemadminstrator (evtl. geschieden nach Hardware- und
Softwarebetreuung), Listowner (evtl. Listmaster), Moderator, Mitglied,
Teilnehmer),
- der Automatisierung des Betriebsablaufs sowie insbesondere
- der Konditionierung der Zugangsberechtigung (offen/ geschlossen),
der Publikationsberechtigung (allseitig/ einseitig, mehrseitig) und
der Bewertungsberechtigung (moderiert/ unmoderiert, member-scored).
Neben diesen zwei pragmatisch orientierten Definitionen von Mailinglist läßt sich im theoretisch strenger zugespitzten, soziologischen Sinne unter einer Mailinglist ein Diskursmedium verstehen, das eine generelle Führbarkeit von Diskursen auf der Basis des Verbreitungsmediums E-Mail ermöglicht. Die kommunikative Form einer Mailinglist operiert entlang von Beitrag und Nichtbeitrag. Die beiden Seiten Beitrag und Nichtbeitrag sind nicht instruktiv, sie legen thematisch nichts fest. Instruktiv ist dagegen die Differenz beider Seiten bzw. die Beobachtung, die entsteht, wenn die jeweils nicht-aktualisierte Seite mit einbezogen wird. Zuviele oder zuwenige und vor allem als falsch taxierte Beiträge ziehen Folgebeiträge nach sich, die genau das zum Thema machen. Wiederholen sich derartige Beiträge regelmäßig, sind Ausdifferenzierungen zu erwarten, etwa die Eröffnung einer thematisch spezialisierterer Mailinglists oder die Einführung einer Redaktion, Moderation oder eines Bewertungsverfahrens. Die Konditionierung der Beiträge durch die selbstreferentielle Schließung und dem fremdreferentiellen Umweltzugriff geschieht anhand von Themen bzw. Themenwechseln. Die Themen sorgen für den Anschluß von Beiträgen an Beiträge, die Themenwechsel für Neubeiträge und das Rekrutieren weiteren Personals. In diesem Sinne ist es zu rechtfertigen, von einer Mailinglist als einem sozialen System zu sprechen.
Allerdings gelingt es nicht, Mailinglist-Systemen nur einem der drei Systemtypen - Interaktions-, Organisations- und Gesellschaftssystem (vgl. Luhmann 1997, Band 2: 595f) - zuzuordnen, weil auf Mailinglist-Systeme Merkmale von allen drei Systemtypen zutreffen: So ist die binäre Zuspitzung ein Kennzeichen von Gesellschaftsubsystemen. Die Voraussetzung einer Mitgliedschaft zur Teilnahme an einer Mailinglist ist typisch für Organisationen. Und die Kapazität der Kommunikationen wiederum entspricht weitgehend eher der von Interaktionssystemen unter Anwesenden. Insofern läge es nahe dafür zu plädieren, entweder die vorgelegte Systemtypologie neu zuzuschneiden oder aber wahrscheinlicher für Strukturen elektronisch gestützter Kommunikationen einen vierten Typus einzuführen.
2.5.1 Die typischen Konflikte
Die Art der diskursiven Auseinandersetzung insbesondere in offen zugänglichen Mailinglists ist paradigmatisch für die spezifisch neue Qualität netzgestützer Kommunikation, Kooperation, Koordination, Konnektivität und Interoperationalität. Als Diskursforen organisierte Mailinglists brechen im Schriftmedium die vom Buchdruck erzeugte Trennung von Sender und Empfänger auf und stellen neue Formen für organisatorische Rearrangements zur Verfügung. Das bedeutet zugleich, dass mit der Zunahme der Nutzung von Mailinglists auch mit einem Anwachsen von bislang stillgelegten sowie neuartigen Konflikten zu rechnen ist.
Bislang interessieren sich nur wenige Betreiber und Nutzer von Mailinglists für die damit einhergehenden konventionellen politischen Konfliktlagen. Solche konventionellen Konfliktlagen beträfen beispielsweise die der Legitimation von Entscheidungen der Mailinglist-Betreiber, der rechtlichen Absicherung der Listowner und Moderatoren oder auch die datenschutzrechtlichen Bestimmungen, die beim Betrieb einer Mailinglist einzuhalten sind. Einzig die Frage, inwieweit gehaltvolle Mailinglistbeiträge von anderen Mitgliedern in andere Medien transferiert verwertet werden dürfen, wird verläßlich wiederkehrend zumindest hin und wieder thematisiert. Solche klassischen Konfliktthemen sind trotz ihrer Dethematisierung durch die Technikentwicklungen nicht obsolet geworden, ganz im Gegenteil. Fragen wie die nach dem Eigentum an Texten (bzw. an den darin geäußerten Ideen) müssen dringend neu beantwortet werden, weil das Netz als Massenmedium sich in einer gesellschaftlich turbulenten Umgebung befindet, in der Konflikte nicht mehr allein durch die bislang im Netz vorherrschende "informelle" Regulierungsform der gentlemen-agreements, sozusagen im Modus virtueller Handschläge, beizulegen sind und rechtliche Konflikte, wenn sie zu lange offen gehalten werden, entweder durch den faktischen Technikeinsatz anschliessend nur noch schwer änderbar oder durch operative Hektik überstürzt festgeschrieben werden.
Offen zugängliche Mailinglists wurden bislang überwiegend von besonders engagierten Einzelpersonen gegründet. In den Anfangszeiten der Mailinglist-Nutzung waren diese engagierten Personen auf die Infrastruktur der Universitäten oder Firmen mit großer EDV-Abteilung angewiesen, um den organisatorischen, technischen und finanziellen Betrieb einer Mailinglist nebenher aufrecht erhalten zu können. Seit Mitte der 80er Jahre war es dann auch einzelnen Personen in breitem Umfang möglich geworden, die technische Infrastruktur von Mailinglist privat finanzieren. Das lag zum einen am Preisverfall im Hardware-Bereich, an der allmählichen Ausbreitung von Unix-Know-How sowie insbesondere an der Entwicklung frei zugänglicher Unix-Betriebssysteme wie BSD und, ab den frühen 90er Jahren, insbesondere Linux. In den Pionierzeiten der Netznutzung, deren Ende sich mit dem Aufkommen des World-Wide-Web so um 1994 datieren liesse, waren Mailinglist-Mitglieder in der Regel froh darüber, dass ein Forum zur Verfügung gestellt wurde und sich jemand um die Bewältigung der Technik kümmerte. Das Interesse an Funktionalität ließ (datenschutz-)rechtliche oder demokratietheoretische Bedenken kaum aufkommen, zumal sich Benachteiligungen gegenenfalls über thematisch verwandte Newsgroups öffentlich wirksam beklagen liessen. Diese Kultur der Selbstermächtigung qua Engagement ist im Netz, trotz des anhaltenden Kommerzialisierungs- und Verrechtlichungsdrucks, weltweit noch immer in beträchtlichem Maße anzutreffen. Trotzdem hat sich die Situation ingesamt geändert, insbesondere weil Institutionen den Wert von Mailinglists sowohl für die interne wie auch externe Kommunikation entdeckt haben und damit formalisierte Rechtsansprüche an Bedeutung gewinnen. Während in offen zugänglichen Mailinglist die Frage latent im Vordergrund stehen mag, ob Beiträge daraus von jedem Mitglied beliebig weiterverwendet werden dürfen, stellt sich bei institutionalisierten Teilnehmern zusätzlich die Frage, was diese in welchem Ausmaß und welcher Form sagen dürfen.
Bezogen auf Mailinglists und deren Betreiber und Nutzer lassen sich typische rechtliche und politische Konfliktfelder anführen, die im Zuge der Veralltäglichung des Umgangs mit dem Internet und den darauf aufsetzenden Netzdiensten an Bedeutung gewinnen:
Dem Besitzer einer Mailinglist steht es frei, den Betrieb seiner Mailinglist einzustellen. Mailinglists werden insbesondere dann geschlossen, wenn die Mailinglistinfrastruktur privat finanziert wird. Mailinglists, die von öffentlichen Stellen betrieben oder zumindest finanziert werden, verfügen dagegen über Regeln, nach denen sie betrieben bzw. geschlossen werden. Die Besitzer privat betriebener Mailinglists schliessen ihre Listen erfahrungsgemäß umstandslos dann, wenn sie sich nicht länger für die Thematik der Liste interessieren oder aus ihrer Sicht die Relevanz zweifelhaft geworden ist und nur noch wenige Beiträge im Jahr über die Mailinglist verteilt werden. Oder sie schliessen, weil eine zu große Anzahl an Beiträgen an eine zu große Anzahl an Mitgliedern weiterzuleiten ist und die Betriebskosten den Kalkulationsrahmen übersteigen.
Ein System-Administrator kann den Betrieb einer Mailinglist durch technische Unkenntnis oder natürlich aus Vorsatz stören, und sich die Arbeit des Mailinglistowners oder des Moderatoren anmaßen oder unterlaufen. Wenn es ihm beliebt, kann er Beiträge schlicht löschen oder den Verteilzeitpunkt von Beiträgen durch Manipulation des Mail-Transportprogramms(Endnote 16) hinauszögern und so einen nicht offensichtlichen, aber doch starken Einfluß auf Debatten nehmen. Zudem hat er Einblick in sämtliche Mitgliederdaten und Kommunikationsverläufe der von ihm technisch in Gang gehaltenen Mailinglists.
Ein Mailinglistowner kann zumeist weitgehend unkontrolliert die Liste mit den Mailadressen der Mitglieder manipulieren. Die Betroffenen brauchen in der Regel lange, bis sie merken, dass der Mailinglistowner ihre Adresse aus der Mailinglist entfernt hat - im Konfliktfall kann ein Mailinglistowner zur Begründung technische Mängel bei den Betroffenen vorschieben. Technische Mängel, wie etwa vom Empfänger zurückgewiesene Mails ("bounced mail") oder schlecht eingestellte Antwortautomaten, die die Mailinglist fortgesetzt mit der Meldung penetrieren, dass ein Empfänger bis zum Ende des Monats im Urlaub sei, nehmen einige Mailinglistowner, und insbesondere Verwaltungsautomaten, zum Anlass, Mitglieder von der weiteren Teilnahme an einer Mailinglist auszuschliessen.
Wichtiger weil subtiler ist, dass ein Mailinglistowner die Details der Art und Weise der Kommunikation und damit die Organisationsform einer Liste festlegt. Da er oftmals auch derjenige ist, der die Mailinglist initiiert hat, legt er beim Startup die Zugangs-, Publikations- und Bewertungsberechtigung fest und formuliert neben der Engfassung der Thematik die "Programmatik" der Liste, also in welcher Form die Thematik behandelt werden darf, beispielsweise ob wissenschaftlich oder nicht. Ferner obliegt es seiner Ausgestaltung der Nutzungsbedingungen, welche Datenformate er als unerwünscht erklärt oder ob er darauf besteht, dass die Teilnehmer unter ihren richtigen Namen oder auch unter erkennbaren Pseudonymen (wie etwa Saddam Hussein, Dwight Eisenhower...) teilnehmen dürfen. Er stellt ein, ob den Mitgliedern der freie Zugang auf Datenbestände der Mailinglist, beispielsweise auf die Liste der Teilnehmer oder auf ein regelmäßig erstelltes Beitragsarchiv, gewährt wird oder nicht. Viele Mailinglist-Betreiber machen das Archiv einer Mailinglist ohne Einschränkungen per Web zugänglich, was nicht allen Mitgliedern recht ist, weil dadurch beliebige Interessenten darauf zugreifen können.(Endnote 17)
Moderatoren sehen sich naheliegenderweise dem Vorwurf ausgesetzt, sie zensierten letztlich willkürlich, insbesondere bei Mailinglists mit einem sehr hohen Beitragsaufkommen, zumal wenn sie mangels Zeit keine ausführlichen, auf den Text eingehenden Begründungen für zurückgewiesene Beiträge schreiben. Erfahrungsgemäß spielt dieser auf der Hand liegende Konflikt nur selten eine Rolle, weil die meisten Moderatoren Beiträge im Zweifel eher passieren als es auf eine zeitverschlingende Auseinandersetzung mit dem Autoren ankommen zu lassen.
Die Mitglieder von Mailinglists können eine Mailinglist dadurch mißbrauchen, indem sie sich beispielsweise nur deshalb einschreiben, um an die E-Mailadressen der Liste zu gelangen. Solche Adresslisten von Mailinglists sind marketingmässig hochwertig, das heißt sie lassen sich kommerziell und womöglich auch politisch verwerten, weil den Mitgliedern dieser Liste ein bestimmtes Interessenprofil unterstellt werden darf.
Und die Teilnehmer von Mailinglists können die Nutzung einer Mailinglist dadurch unattraktiv machen, indem sie fortgesetzt Beiträge auf schlechtem Niveau anfertigen, belanglose Kommentare schreiben, permanent persönlich provozieren, nicht beim Thema bleiben oder Beiträge in einem Textverarbeitungsformat verschicken, das nicht von allen Teilnehmern eingelesen werden kann. Ein Mißbrauch besteht auch dann, wenn eine auf die Ermöglichung von realen Diskursen zielende Mailinglist als ein billiger Vertriebskanal zum Versand abgeschlossener Publikationen benutzt wird.
Bei geschlossenen-betriebenen Mailinglists spielen diese hier knapp angerissenen Konflikte eine eher geringe Rolle, weil der Betreiber einer geschlossenen Mailinglists zumeist in einem qualifizierten Vertrauensverhältnis zu den meist nur wenigen Mitgliedern steht. Anders sieht die Situation, insbesondere was die Ansprüche an Datenschutz der Mitglieder oder auch die Verfahren zur Auswahl und Bewertung von Mailinglist-Beiträgen angeht, bei offen zugänglichen wissenschaftsorientieren Mailinglists mit mehreren Hunderten oder Tausenden an Mitgliedern aus. Es lohnt, diesen Themen zu vertiefen.
2.6 Die datenschutzrechtlichen Aspekte
Der Datenschutz ist im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung ein Teil eines dilemmatösen Dreiecks, bei dem drei Ziele formuliert sind, die jeweils für sich Unbedingtheit beanspruchen, insgesamt jedoch nicht widerspruchsfrei realisiert werden können:
- Technische Funktionalität
- Technische Sicherheit
- Datenschutz
In Bezug auf elektronisch vernetzte Kommunikationstechniken zielt der Aspekt der technischen Funktionalität auf die von Nutzern gewünschten Netzdienste, wie beispielsweise Webzugang, E-Mail oder Videokonferenzen, die ein Betreiber möglichst ohne Einschränkungen den eigenen Benutzern bzw. den Interessenten und Kunden aus dem Netz in bestmöglicher Qualität, sprich hochverfügbar und mit maximaler Geschwindigkeit, zur Verfügung stellen möchte. Der Aspekt der technischen Sicherheit reicht von einer hinreichend redundant ausgelegten Rechnerausstattung bis vor allem zum Schutz vor Missbrauch der Rechner durch Hacker hin. Und unter dem Aspekt des Datenschutzes wird vornehmlich der Umgang speziell mit personenbezogenen Daten thematisiert. Der Umfang von auf Personen beziehbare Daten kann vom Eintrittsdatum eines Mailinglistmitglieds, über die E-Mailadresse, die auf den Arbeitgeber hinweist bis zur der Signature, also dem Abspann einer Beitrags, reichen, in der womöglich spezielle Vorlieben und die private Anschrift mitgeteilt werden.
Die Steigerung der technischen Sicherheit kann die technische Funktionalität eines EDV-Systems beeinträchtigen, wenn beispielsweise durch Zuschnüren einer Firewall klassische Netzdienste wie FTP oder Telnet, aufgrund ihres hohen inhärenten Risikos als Einfalltor für Hackversuche oder aufgrund ihrer unverschlüsselten Datenweiterleitung auch von Passworten, nicht zugelassen werden. Ebenso kann der Datenschutz beeinträchtigt werden, wenn technisch bedingte Protokolldaten - beispielsweise diejenigen, die an einer Firewall ganz gezielt erzeugt werden, damit der Systemverwalter jedes einzelne Datenpäckchen aufs Bit genau beobachten kann, um auf etwaige Hacker-Angriffe reagieren zu können - für hochauflösende Benutzerprofile zusammengestellt werden.(Endnote 18) In der Praxis muss das Ausmaß der Oszillation des Arbeitspunkts eines EDV-Systems deshalb als Kompromiß innerhalb der vom dilemmatösen Dreieck aufgespannten Fläche liegen, wobei dieser kaum anders als durch empirische Optimierungen zu ermitteln ist, zumal es weitere limitierende Faktoren, wie etwa das des insgesamt angestrebten Sicherheitsniveaus, des Know-Hows des Personals, der technischen Altlasten, der speziellen personalen Kontexte sowie nicht zuletzt der Kosten gibt.
Trotz des großen Regelungsbedarfs steht eine juristisch fundierte Diskussion zur rechtlichen Einordnung von Mailinglists, mit Ausnahme einiger eher kursorischer Kommentare, bislang aus. Allein die Entscheidung darüber, ob Mailinglists als Teledienst, und datenschutzrechtlich damit dem Teledienstedatenschutzgesetz (TDDSG) als Artikel 2 des umfassenden Informations- und Kommunikationsdienste-Gesetzes (IuKDG), oder als Mediendienst aufzufassen sind, und damit dem Mediendienstestaatsvertrag (MDSV) zuzuordnen, ist nicht einfach zu treffen.(Endnote 19)
Spindler macht in seinem Kommentar für den Geltungsbereich des TDDSG die rechtliche Zuordnung von Mailinglists davon abhängig, ob diese für einen eingeschränkten, "überschaubaren" Teilnehmerkreis eingerichtet wurden, dann gelte das TDDSG, oder ob Mailinglists einem "unbegrenzten Teilnehmerkreis offenstehen und redaktionell gestaltete Nachrichten versenden", dann gelte das MDSV. Ausdrücklich heißt es jedoch: Falls eingehende Mails nur automatisch vervielfältigt, aber nicht redaktionell betreut würden, gelte das MDSV nicht, entsprechend Abs. 4 Nr. 3 (vgl. Spindler in Roßnagel 1999: 2/27). Insofern wären die hier untersuchten Mailinglists nicht dem MDSV zuzuordnen. Liest man dagegen Meier, einen Kommentatoren für den Geltungsbereich des MDSV, so empfiehlt dieser ebenfalls eine Einzelfallprüfung und fügt als weiteres mögliches Zuordnungskriterium die Anzahl der Teilnehmer hinzu (vgl. Meier in Roßnagel 1999: 2/27).(Endnote 20)
Man bekommt mehr Klarheit in die rechtliche Situation, wenn die verschiedenen Organisationsformen von Mailinglists unterschieden werden, die auf der basalen Mailinglist-Technik, nämlich E-Mails an eine endliche Liste von E-Mailadressen zu schicken, aufsetzen. Entsprechend den obigen Unterscheidungen einiger typischer Mailinglists-Organisationsformen unterstehen Projektmailinglists vermutlich am eindeutigsten dem Teledienstgesetz. Elektronische Zeitschriften, Presseverteiler oder Werbebroschüren, die auf Mailinglist-Technik aufsetzen, unterstehen dagegen dem Mediendienste-Staatsvertrag. Bei den Diskursforen ist die Zuordnung zum MDSV formal relativ eindeutig für den Fall, dass sie moderiert, also redaktionell betreut werden. Bei offenen, unmoderierten Diskursforen mit allseitigem Publikationsrecht, wie es auf die hier untersuchten Mailinglists zutrifft, liesse sich die Zuordnung gemäß Meier von der Anzahl der Mitglieder abhängig machen, so dass sich beispielsweise die hier untersuchten Mailinglists mit ihren jeweils über 400 Mitgliedern sicherlich dem MDSV zuordnen liessen. Aber ob diese tatsächlich nicht als Individualkommunikation, sondern als ein "(...) an die Allgemeinheit gerichteten Informations- und Kommunikationsdienst" (§2 MDSV, Abs. 1) zu verstehen sind? Eine solche Interpretation könnte mit dem Selbstverständnis der aktiven Teilnehmer solcher Diskursforen kollidieren. Während passive Mitglieder ein Diskursforum womöglich im Modus einer elektronischen Zeitschrift benutzen, könnten es gerade zumindest einige der aktiv schreibenden Teilnehmer eine Mailinglist sein, die die Mailinglist eher als einen anregenden, unverbindlich-spielerischen Plauschkreis unter Gleichgesinnten wahrnehmen. Einige der Kommentare aus dem nachfolgenden empirischen Teil dieser Untersuchung weisen jedenfalls auf ein solches Verständnis von Mailinglists hin.
Wenn die "Überschaubarkeit" der Empfängergruppe als Kriterium für die Zuordnung eines Diskursforums herangezogen wird, dann sollte diese, trotz des Vorteils der einfachen Operationalisierbarkeit, nicht anhand der Anzahl der E-Mail-Adressen, sondern anhand der Anzahl der möglichen Empfänger eines Beitrags bemessen werden. Beides ist ja, wie bereits kurz diskutiert, nicht zwingend deckungsgleich. Die Frage wäre demnach, in welchem Maße die Beiträge einer Mailinglist kontrollierbar diffundieren. Im Falle interner Projektmailinglists beispielsweise darf man davon ausgehen, dass die Beiträge ganz überwiegend nur die eingeschriebenen Mitglieder erreichen, eine entsprechende Übereinkunft unter den Mitgliedern vorausgesetzt. Dies kann genau so auch bei sehr großen mitgliederstarken, offen zugänglichen Mailinglists der Fall sein. Insofern ist dies ein Plädoyer dafür, Diskursforen auf Basis von Mailinglist-Technik zunächst grundsätzlich als einen Teledienst einzustufen und nur in Zweifelsfällen eine Abschätzung über den Grad der über die E-Mailadressen der Mailinglist hinausgehende, praktisch unkontrollierbare, anonym-broadcastsenderartige Diffusion von Beiträgen vorzunehmen.(Endnote 21)
Die Zuordnung einer Mailinglist zu einem der beiden Gesetze ist bei einer ganzen Reihe an Fragen von Bedeutung. Wird eine Mailinglist beispielsweise dem MDSV zugeordnet, würden an den Mailinglistbetreiber, wer auch immer damit dann konkret gemeint ist, im Vergleich zum einem Anbieter gemäß TDG erhöhte Anforderungen der "Anbieterkennzeichnung" (§6) gestellt: Dieser muss seinen ständigen Aufenthalt im Inland haben, zur Bekleidung öffentlicher Ämter berechtigt sein und über eine volle Geschäftsfähigkeit und unbeschränkte Strafverfolgbarkeit verfügen. Desweiteren sind im MDSV explizit Themen und Arten ihrer Behandlung aufgeführt, zu denen keine "Mediendienste", sprich öffentliche Mailinglists mit vielen Hundert Mitgliedern angeboten werden dürfen, wie etwa Kriegsverherrlichung, Verharmlosung von Gewalttätigkeiten, Pornografie usw. (vgl. §8). Desweiteren haben die Nutzer, also die Mailinglistmitglieder, mehr Rechte bezüglich ihres Auskunftrechts gegenüber dem Anbieter (Mailinglistbetreiber). Darüberhinaus muss auch Nichtmitgliedern(!) einer Mailinglist, die unter das MDSV subsummiert würde, unter Umständen ein Recht auf Gegendarstellung gewährt werden. Diese Regelung dürfte insbesondere dann eine Rolle spielen, wenn eine Mailinglist mit einseitigem Publikationsrecht oder moderiert ausgelegt ist und Mitglieder keinen unmittelbaren Einfluß auf die Beiträge nehmen können.
Zweifelsfrei dürfte für Mailinglists natürlich dasjenige gelten, was nach beiden Gesetzen gilt: Personenbezogene Daten dürfen nur dann verarbeitet werden, wenn eine Rechtsgrundlage vorliegt und der Betroffene bzw. Nutzer in die Verarbeitung der Daten explizit eingewilligt hat. Ungleich weniger zweifelsfrei läßt sich jedoch wiederum die tatsächliche Bedeutung dieser Regelungen für Mailinglists feststellen.
Man kann zwar den Standpunkt vertreten, dass eine Subscribtion als Einwilligung in die Verarbeitung von Daten im Rahmen der üblichen Verwaltung von Mailinglists gelten darf, doch enthält dieser Standpunkt zwei Schwachpunkte: Erstens ist es fraglich, ob sich der Subscribent zuvor über die Art der Verarbeitung seiner Daten seitens des Mailinglistbetreibers informiert hat bzw. informieren konnte. Dazu gehört beispielsweise das Wissen darüber, wer welche Daten zu welchem Zweck speichert, verarbeitet, wem übermittelt und wie lange dies jeweils geschieht (vgl. § 3 Abs. 5 TDDSG bzw. §12 Abs. 6 MDSV). Zweitens sind die Ansprüche des TDDSG an die Einwilligung seitens eines Nutzers einer datenverarbeitenden Stelle eigentlich hoch: Ein Nutzer muss seine Zustimmung entweder traditionell schriftlich auf Papier fixiert oder mit Hilfe einer digitalen Signatur, wie im IuKDG ausgeführt, abgesichert geben. Beides ist im Umgang mit Mailinglist bislang vollkommen unübliche Praxis.
Desweiteren gilt bei beiden Gesetzen grundsätzlich, dass die Verarbeitung der Daten durch die datenverarbeitende Stelle nur insoweit geschehen darf, wie sie für die Aufrechterhaltung des Betriebs erforderlich ist. Die datenverarbeitende Stelle (bzw. ein Anbieter) hat dabei die Gebote der Datensparsamkeit und Datenvermeidung zu beachten. Diese Anforderungen sind durchaus nicht unproblematisch, wenn man an einen Interessenten denkt, der vor dem Subscribieren einer offen zugänglichen Mailinglist etwa auf Abschaffung der Abrufmöglichkeit der Mitgliederliste(Endnote 22) besteht, wenn es zugleich gerade im Sinne der Steigerung des persönlichen Datenschutzes eines Nutzers sein kann, wenn dieser sich vor der Publikation eines Beitrags vergewissern möchte, wer in der Mailinglist mitliest und dann gegebenenfalls von einer Publikation absieht.
Wichtiger jedoch ist die Klärung der Frage, wer bei einer Mailinglist als Anbieter oder datenverarbeitende Stelle ausgewiesen ist. Gemäß obiger Differenzierung des Personals kämen dafür der Besitzer, der System-Administrator, der Mailinglistowner und eventuell auch der Moderator, von den weiteren sinnvollen Differenzierungen abgesehen infrage. In der Regel stehen nur der Besitzer und der System-Administrator in einem explizit vertraglich geordneten Rechtsverhältnis. Die Mailinglistowner und Moderatoren arbeiten dagegen in den meisten Fällen bei offen zugänglichen Mailinglists ehrenamtlich, und selbst dieses Verhältnis wird in der Regel nirgends als ein solches festgestellt.
Auch wenn klargestellt werden kann, wer als Betreiber zu gelten hat, ist das Verhältnis zwischen Betreibern und Mitgliedern eine weitere offene Frage. Womöglich liesse sich dieses Verhältnis annähernd mit einem "Kundenverhältnis" gleichsetzen, wobei der Begriff der "Geschäftsmäßigkeit" auf "Regelmäßigkeit oder auf Wiederholung ausgerichtet" ist. Diese Klärung hätte allerdings wiederum zur Folge, dass jeder Netzteilnehmer im Internet recht schnell datenverarbeitende Stelle werden kann, allein dadurch, dass er Beiträge von Mailinglists archiviert. Solange dies im stillen Kämmerlein abläuft, spielt es keine Rolle. Aber wenn Dritten die Nutzung oder Auswertungsergebnisse personenbezogener Daten angeboten werden, dann erreicht man den Gesetzesbereich. Dabei kommt die Sachlage weiter erschwerend hinzu, dass für wissenschaftliche Zwecke wiederum Ausnahmen gelten, die für die hier vorgelegte Studie in Anspruch genommen werden.
Mit Bezug auf Mailinglists bleibt demnach festzuhalten, dass a) weder die Rechtsgrundlage in jedem Falle als gesichert noch b) Schriftlichkeit bzw. digitale Signatur bei der Einwilligung in die Datenverarbeitung als gegeben noch c) als hinreichend spezifiziert gelten kann, was als datenverarbeitende Stelle zu gelten hat und d) wie das Verhältnis zwischen Betreiber und Nutzer einzuordnen ist.
In dieser gegenwärtig unübersichtlichen Situation behilft man sich seitens des Datenschutzes damit, dass hier zum einen im TDG vorausschauend die Einwilligungsanforderungen übergangsweise etwas zurückgeschraubt wurden. Zum zweiten wird der Ansatz verfolgt: "Wer sich in Gefahr begibt, muss wissen, worauf er sich einläßt.". Drittens finden sich in den seit wenigen Jahren eigens angefertigten Broschüren sowie den jährlich publizierten Tätigkeitsberichten der Datenschützer jede Menge Informationen zum sicheren Umgang mit dem Internet. Dort werden zunehmend ausführlicher Tools für den Selbstdatenschutz besprochen oder auf den Websites angeboten. Dieser anders als pragmatisch kaum gangbare Weg wurde u.a. durch Alexander Roßnagels "Ohnmacht des Staates" juristisch vorgezeichnet (vgl. Roßnagel 1997), indem er den Juristen klar vor Augen führte, wie sehr sie in Bezug auf die neuen Kommunikationmedien in ihrer traditionellen Begrifflichkeit schwimmen.
Festhalten darf man trotz aller Probleme bei der rechtlich korrekten Zuordnung, dass es wünschenswert wäre, wenn insbesondere die datenschutzrechtlich relevanten Selbstbindungen der Mailinglistbetreiber in deren Netiquetten formuliert wären und dadurch zumindest ein breiteres Bewußtsein für die eigentümliche Datenschutzproblematik, die seitens der Datenschutzinstitutionen einen "neuen Datenschutz" erfordert (vgl. Bäumler 1998), im Internet entstünde.
Diese Problemkonstellationen lassen sich aus meiner Sicht als weitere Indikatoren für das Ausmaß der Veränderungen interpretieren, die mit der breiten Nutzung des Internet einhergehen (vgl. Weichert 2000). Unter Datenschutzperspektive gilt für den Alltag der Mailinglistnutzung, dass alle Beteiligten generell auf Datenvermeidung bzw. Datensparsamkeit achten und zugleich auf möglichst viel Transparenz und Kontrollmöglichkeiten durch die Nutzer selbst setzen sollten.
2.7 Das Konfliktmanagement
Zur Konfliktregulation von sozialen Kontakten über das Netz wurden einige netzeigene Instrumente entwickelt. Generell sind in den RFC-Texten ("Request-For-Comments") die empfohlenen Standards für das technische und organisationelle Funktionieren der Netzkommunikation niedergelegt.
Um die enorme Gestaltungsmacht von System-Administratoren einzuschränken, wird in besonders sensiblen Fällen, beispielsweise bei der Verwaltung von Verschlüsselungssoftware, auf die Einhaltung eines Mehraugen-Prinzips geachtet.(Endnote 23)
Für die Ebene der thematischen Netz-Kommunikation bemessen sich Regelverstöße an der Netiquette:
"Netiquette beschreibt das als angemessen und richtig geltende Verfahren in der Netzwelt auf der Grundlage eines Minimalkonsenses bezüglich richtigem Verhalten, das als notwendig zur Erreichung eines möglichst optimalen Datenflusses bei möglichst optimaler Konnektivität gilt." (Helmers/ Hoffmann/ Hofmann 1998: 26)
Die Netiquette, die zwar insbesondere für die Teilnahme an öffentlichen Newsgroups des UseNet formuliert wurde, aber inzwischen als verallgemeinert für alle Diskursforen des Netzes gilt, wird in ihrer deutschen Version zum Beispiel regelmäßig in der Newsgroup de.newusers veröffentlicht. Lutz Donnerhacke, einer der Koordinatoren des deutschsprachigen Teils des UseNet, führt dazu aus (Donnerhacke 1996: 74):
Die wichtigste Verhaltensgrundregel im Usenet lautet: Du kommunizierst mit Menschen. Fast alle anderen Regeln werden aus dieser Regel abgeleitet. Man soll seine Artikel so posten (versenden), dass...
- sie in der thematisch am besten passenden Gruppe landen, damit der Leser einer Gruppe sich nicht um Dinge kümmern muss, die er nicht lesen wollte.
- der Leser den Artikel auch wirklich lesen kann. Das heißt also:
- in der Sprache, die in der Gruppe üblich ist.
- in möglichst reinem ASCII, d.h. reine Texte, keinesfalls Dateien aus einer Textverarbeitung, Bilder oder gar Programme.
- die Zeilen spätestens nach 75 Zeichen umzubrechen.
- möglichst wenig überflüssige Zeichen enthalten sind, wie z.B. automatisch erzeugte Einführungstexte oder Endtexte (Signaturen). Viele Leute benutzen Modems um die Daten zu bekommen, und das kostet Geld.
- man in Antworten auf andere Artikel die Passagen zitiert, auf die man antwortet. Der Rest ist zu löschen!
- private Antworten nicht öffentlich gepostet werden, sondern per Email geschickt werden.
- keine sinnfreien "Ich auch" oder "Haben wollen" Artikel produziert werden.
Desweiteren gilt, dass es sehr unhöflich ist...
- in Gruppen zu posten, die man selbst nicht liest, denn nichts ist nervender für die Leserschaft, nach einer Antwort die gleichen Fragen immer und immer wieder zu lesen.
- seinen richtigen Namen nicht zu nennen. Man muss seine eigene Software einfach soweit im Griff haben, dass neben einem etwaig verwendeten Pseudonym immer auch ein normaler Name angegeben ist.
- einen Zugang zu verwenden, der keine Email empfangen kann, weil Rückfragen sonst im Nirvana verschwinden.
- ein Posting in mehr als eine Gruppe Crossposting zu versenden, ohne ein Followup-To: (Antwortenumleitung) in genau eine Gruppe zu verwenden.
Die Personen im Netz sind zueinander meist freundlich und aufgeschlossen, man redet sich prinzipell mit "Du" an, das "Sie" ist ungewöhnlich. Etwaig vorhandene Titel bleiben in der Regel ungenannt.
Eine Zusammenstellung weiterer Empfehlungen zur Abwicklung effizienter E-Mailkommunikation findet sich bei Freiermuth (vgl. Freiermuth 2000: 96):
- Prägnante Betreffzeilen
- Informelle Anrede
- Knappe Zitate
- Nicht BRÜLLEN, lieber :)
- Informationsreiche Signature
- Ohne Anhang kommen
- Mail ist keine Schneckenpost
- Vorsichtiges Weiterleiten
- Vorsicht beim ungeschützten Verkehr
- Immitation macht den Kommunikationsmeister
Das Berufen auf derartige Empfehlungen zur externen Regelung von Konflikten verschafft einem Mailinglistowner oder einem Moderator für seine Handlungen jedoch keine verläßliche Legitimation, weil zum einen bei Verstößen seitens der Nutzer ein großer Ermessensspielraum verbleibt und zum anderen keine Sanktionsformen ausgewiesen sind. Deshalb verbleiben als Erwartungsregulierer meist nur Flames, also drastisch formulierte, oftmals ironische, polemische oder auch gezielt verletzende Widersprüche durch andere Teilnehmer der Mailinglist.
Zur Steigerung ihrer rechtlich problematischen Stellung schicken Mailinglistowner und Moderatoren einiger Mailinglists beim Eintritt eines neu eingeschriebenen Mitglieds als erste eine E-Mail mit der allgemeinen Netiquette, der speziellen Nutzungs-Policy für diese Mailinglist sowie in ganz wenigen Fällen auch noch einen Quasi-Nutzungsvertrag zu.(Endnote 24)
Aber auch diese zusätzlichen Regelwerke steigern das Rechtsniveau bzw. die Legitimation der exekutiven Funktionsträger (Betreiber, Sysadmin, Mailinglistowner, Moderator) insbesondere offen zugänglicher Mailinglists nur in einem unzureichend geringen Maße. Die Legitimation eines Regelwerks gründet üblicherweise in einer über positives Recht verfügenden Gesellschaft auf dem Verfahren, mit dem ein Regelwerk zustande gebracht wurde. Gesellschaftlich anerkannt ist in diesem Sinne die demokratische Selbstbindung der Beteiligten sowie die verfahrensmäßige Anbindung an das allgemein bestehende, positive Recht. Wenn ein Mailinglistbetreiber einer offen zugänglichen Mailinglist auf Grundlage des von ihm abgefaßten Regelwerks agiert, das keine formal-rechtliche Anbindung erkennen läßt und allen Neumitgliedern bei deren Anmeldung automatisch zugeschickt wird, dann kann er sich zwar darauf berufen, dass ein Neumitglied dieses Regelwerk qua Fortsetzung der Mitgliedschaft anerkennt, doch bedeutet dies letztlich wenig anderes als ein Verschieben der Willkür des ad-hoc-Eingreifens in die willkürliche Erstellung eines solchen Regelwerks.
Um aus dieser Grauzone der Legitimation zunächst einmal mit Bordmitteln herauszukommen, sind bislang Nutzer und Betreiber einiger Mailinglists dazu übergegangen, tiefgreifende Entscheidungen - die beispielsweise das Regelwerk, die Organisationsform, den Einschluss oder Ausschluss von Mitgliedern oder die befristet-pauschale Mandatserteilung insbesondere des Mailinglistowners oder Moderators betreffen -, durch Mehrheitsbeschlüsse unter den Mitgliedern herzustellen und abzusichern. Andere Listen setzen auf Initiative von Mitgliedern ein Verfahren ingang, das ebenfalls mit einer Mehrheitsentscheidung abgeschlossen wird und analog dem Verfahren zur Einrichtung neuer Newsgroups funktioniert: Ein Teilnehmer startet ein RfD ("Request for Discussion") und initiiert formal dadurch eine in der Regel mindestens 14 Tage währende Diskussionsphase. Anschliessend folgt ein CfV ("Call for Vote"), eine in der Regel mindestens 7 Tage währende Abstimmungsphase (vgl. Donnerhacke 1996; Rost 1999b). Die Entmachtung des Mailinglistowners durch derart demokratische Rückbindungen an Entscheidungen der Mitglieder einerseits bedeutet andererseits eine Steigerung seiner Legitimation durch Absicherung der bisher weitgehend ungesicherten politisch-rechtlichen Position der Mailinglist-Exekutive.
Während die Legitimation des Mailinglistowners und des Moderators problematisch ist, haben es Mailinglist-Besitzer und System-Administratoren gegenüber den Nutzern von Mailinglists dadurch leichter, weil diese den Betrieb einer Mailinglist überhaupt erst möglich machen. Jemand muss als Bedingung der Möglichkeit einer Mailinglist die technische Infrastruktur bezahlen und diese Infrastruktur dann technisch angemessen betreiben. Zwar haben Betreiber und Aministrator dadurch auch die praktisch größte Verfügungsgewalt über ihre Mailinglists inne, doch ist dieser Aspekt machtpolitisch weniger bedeutungsvoll, als es zunächst erscheinen mag. Denn zum einen sind Mailinglist-Betreiber auf die Teilnehmer ihrer Mailinglist angewiesen, weil erst gehaltvolle Debatten eine Mailinglist attraktiv machen, so dass es für thematisch Interessierte zu einem "must" wird, sich in diese Mailinglist einzuschreiben. Zum zweiten steht es jedem anderen E-Mail nutzenden Netzteilnehmer frei, selbsttätig eine Mailinglist nach eigenem Ermessen einzurichten, zu betreiben und an strategisch empfehlenswerten Stellen im Netz (sprich: durch Anmelden in Suchmaschinen und Katalogen) zu bewerben.(Endnote 25)
Es kann nach dem bisher gesagten insofern nützlich sein, offen zugängliche von öffentlichen Mailinglists zu unterscheiden. Als öffentliche liesse sich eine Mailinglist bezeichnen, an der keine private Trägerschaft besteht, die Subscription automatisiert erfolgt und eine allseitige Publikationsberechtigung ohne Moderation gegeben ist. Darüberhinaus sollten in einer öffentlichen Mailinglist die Regeln kenntlich gemacht sein, die die Mitglieder und die Exekutive einer Mailinglist in ein klar geregeltes Verhältnis zueinander setzen. Bislang spielt diese Unterscheidung in der Literatur allerding keine Rolle: Wenn dort von öffentlichen Mailinglists die Rede ist, dann im Sinne dieses Textes als offen zugängliche Mailinglists.
Eine Steigerung der rechtlichen Einbindung des Personals von Mailinglists (bzw. der Mailinglists selber) ist spätestens dann zu erwarten, wenn das Einhalten datenschutzrechtlicher Bestimmungen zu personenbezogenen Verkehrs- und Inhaltsdaten zur tatsächlich eingeübten Praxis werden muss -, und/ oder wenn für das Betreiben und für die womöglich redaktionelle Betreuung von Mailinglists Geld gezahlt wird und somit die Nutzer auch stärkere Rechtsansprüche als bislang an die Betreiber von Mailinglists stellen.
Endnoten
Endnote 1: Zum Einschreiben in eine Mailinglist muss in der Regel eine E-Mail mit dem Befehl subscribe Name_der_Mailinglist Vorname Nachname an die Verwaltungsadresse des Mailinglists-Servers geschickt werden. Das Austragen aus der Mailinglist geschieht mit unsubscribe Name_der_Mailinglist. Diese Befehlssyntax hat sich als Defacto-Standard unter den wichtigsten Programmen zum automatisierten Ein- und Austragen von neuen Mailinglist-Mitgliedern herausgebildet. Allerdings weicht der neue Stern am Himmel der Mailinglistsoftware ezmlm von diesem defacto-Standard ab, weil hier die Befehle als Namensbestandteil der E-Mailadresse unterzubringen sind. - zurück -
Endnote 2: Trotz Bedenken gegen eine Sprache, die ein Geschlecht bevorzugt, wird fortan bei Gattungsbegriffen oder Beispielen aus stilistischen Gründen auf die konsequente Berücksichtigung auch der weiblichen Wortformen verzichtet. - zurück -
Endnote 3: Das tatsächlich zu erzielende Maß an Bestimmbarkeit des Sets an Empfängern ist beispielsweise dann von Belang, wenn eine Mailinglist juristisch als ein auf das Birektionale zielender Teledienst oder als ein auf ein Broadcasting-Modell zielender Mediendienst eingestuft werden soll. Dieser rechtlich bedeutsame Unterschied wird später noch genauer verfolgt werden. - zurück -
Endnote 4: Auch dieser Aspekt wird im Verlauf der Studie gründlicher angesprochen werden. - zurück -
Endnote 5: Einen Überblick zu Newsletter, die auf Mailinglist-Technik ausetzen, ist zu finden bei Goltzsch (Goltzsch 2000). - zurück -
Endnote 6: Dies liesse sich für den hier angestrebten, spezifischen Fokus auf sozialwissenschaftlich orientierte Mailinglists anhand der Newsgroups alt.sci.sociology und de.sci.soziologie beispielhaft nachweisen. - zurück -
Endnote 7: Protokolle von Chats lassen sich, auch wenn sie maschinell nachbereitet werden, kaum lesen, wie ein entsprechendes Experiment von Kristian Köhntopp belegt. - zurück -
Endnote 8: Patrick Goltzsch hat ein paar Beobachtungen und
Überlegungen zum Scheitern von (gerade auch engagiert
betriebenen) Webforen zusammengetragen
"come.to/discuss".
- zurück -
Endnote 9: Dieses Mailinglistpaket ist auf jeder aktuellen Linux-Distribution enthalten. - zurück -
Endnote 10: Bei einem Digest werden Pakete mit mehreren Beiträgen in einem festen wöchentlichen oder monatlichen Rhythmus oder nach dem Erreichen eines bestimmten Umfangs zugeschickt. - zurück -
Endnote 11: Der Unterschied zwischen einer manuell und einer vollautomatisch betriebenen Mailinglists zeigt sich insbesondere im Umgang mit Fehlern: Während ein Automat eine E-Mailadresse aus der Mailinglist streicht, sobald eine gewisse Zeit verstrichen oder eine definierte Anzahl von Fehlermeldungen über die Nichtzustellbarkeit von Beiträgen eingetroffen ist, bemüht sich ein Mailinglistowner zumeist darum, den Ursachen solcher Fehlermeldungen nachzugehen, um auf jeden Fall unberechtigte Löschungen von E-Mailadressen zu vermeiden. - zurück -
Endnote 12: In den Manuals einiger Mailinglistprogramme ist statt von offen oder geschlossen zugänglichen Mailinglists von öffentlichen oder privaten Mailinglists die Rede. Die Unterscheidung privat/ öffentlich soll der Bezeichnung der Besitzverhältnisse an einer Mailinglist vorbehalten werden. - zurück -
Endnote 13: Eine über das Internet geschlossen operierende Mailinglist sollte sinnvollerweise ihre Mails verschlüsselt zustellen. Weil es im Bereich der Mailverschlüsselung noch immer an einem weithin durchgesetzten Standard mangelt und die üblicherweise eingesetzten Mailinglistpakete Verschlüsselung (deshalb) bislang nicht unterstützen, kann man sich bei einem Mailverteiler auf einer Unix-Maschine zumindest mit folgendem Workaround behelfen. Auf der Basis des Mailfilters procmail und des Verschlüsselungprogramms PGP (bzw. GnuPGP oder GPG) lassen sich Mails, die mit dem öffentlichen Schlüssel des Mailverteilers kodiert an den Mailverteiler geschickt werden, automatisch dekodieren und mit den öffentlichen Schlüsseln der einzelnen Mailinglistmitglieder kodiert zustellen. Wenn dem Betreiber des Mailverteilers vertraut werden kann, ist dies eine für viele Fälle hinreichend sichere Lösung. Bei einem kompromisslos hohen Sicherheitsbedarf müssen verschlüsselte Mails direkt vom Sender an die Empfänger adressiert werden. - zurück -
Endnote 14: Meist starteten offen zugängliche Mailinglists zunächst ohne einen Moderatoren. Dann musste aber eine Lösung dafür gefunden werden, dass nicht einzelne Teilnehmer ihre ganz individuellen Sorgen umfangreich und rücksichtslos langwierig ausbreiteten. Die von einem Moderator offensichtlich ausgeübte Zensur wird um die Steigerung der inhaltlichen Qualität und des Funktionierens der Liste willen, in der es nicht um die Entfaltung des "seltsamen Zwangs des besseren Arguments" (Habermas) geht, inkauf genommen. - zurück -
Endnote 15: Dabei ist anzumerken, dass die Empfänger der Mitteilungen die technischen Empfangskosten (Netzzugang) übernehmen müssen. - zurück -
Endnote 16: Genauer gesagt, des Mail-Transport-Agents. Als MTAs, die über das technische Prozedere von E-Mail bestimmen, kommen typischerweise sendmail, qmail, postfix oder smail zum Einsatz. - zurück -
Endnote 17: Bei der Archivierung von Beiträgen stellen sich eine ganze Reihe an weitergehenden Fragen wie etwa die nach der Dauer der Archivierung und ob den Teilnehmern das Recht eingeräumt wird, ihre Beiträge zu korrigieren oder aus dem Archiv entfernen zu dürfen bzw. entfernen zu lassen. Dies spricht auf den Konflikt an, welcher Orientierung der Archivierung von Beiträgen der Primat zukommt: Der historisch-authentischen, wonach nichts am Archiv nachträglich verändert werden darf, oder der sachlich-nutzorientierten Archivierung, wonach etwaige Fehler zwecks Effektivierung der Recherchen Dritter nachträglich behoben und auch problematische Originalbeiträge gelöscht werden dürfen. - zurück -
Endnote 18: Deshalb besteht eine Forderung des Datenschutzes im Rahmen der Privacy-Enhancing-Technologies ("PET") darin, unverzichtbare Protokolldaten, die auf Personen rückschliessen lassen, pseudonymisiert abzulegen, so dass bei Bedarf ein Rechtstitel eingeholt werden kann, bevor ein Systemverwalter, etwa für die Verfolgung von Hackversuchen, die Zuordung von Pseudonymen und Realnames herstellen darf. - zurück -
"Mediendienste sind die elektronischen Verteil- und Abrufdienste, bei denen die redaktionelle Gestaltung zur Meinungsbildung für die Allgemeinheit im Vordergrund steht und die unter Benutzung elektromagnetischer Schwingungen ohne Verbindungsleitungen oder längs oder mittels eines Leiters verbreitet werden. (...)
Teledienste sind elektronische Informations- und Kommunikationsdienste, die für eine individuelle Nutzung bestimmt sind und denen eine Übermittlung mittels Telekommunikation zugrunde liegt." (Landesbeauftragter f.d. Datenschutz SH, 1997: 2).
Es empfiehlt sich meiner Ansicht nach, die Bestimmung eines Mediendienstes um einen selbstbezüglichen Aspekt zu erweitern, nämlich dass elektronische Mediendienste darauf hin angelegt sind, weitere Mediendienste einzubeziehen, so dass die Diffusion von Beiträgen, im Unterschied zu denen von Telediensten, prinzipiell nicht bis zur letzten Empfängeradresse rekonstruiert werden kann. - zurück -
Endnote 20: Diese wenig übersichtliche Situation der Zuordnung kommentiert Spindler wie folgt:
"Sicherlich zeigen die hier gemachten Ausführungen, dass eine präzise Zuordnung der einerseits zu §2 MDStV und andererseits zu §2 TDG sowie drittens zum Rundfunk nach §2 Abs. 1 RstV zwar möglich ist, aber gleichzeitig wird deutlich, dass dazu im Einzelfall eine nicht immer einfache und eindeutige Subsumtion nötig sein wird. Dies bringt erhebliche Rechtsunsicherheiten für die vorwiegend nicht juristischen Anwender mit sich. Damit wird das von Bund und Ländern anvisierte Ziel, einen fortschrittlichen Rechtsrahmen für die Multimediaentwicklung zu schaffen, bereits vom Ursprung her konterkariert. (...) Davon kann die rundfunkrechtliche Rechtsprechnung des BVerfG natürlich nicht unberührt bleiben. Es wird sich schon unter dem Aspekt der Multifunktionalität der Dienste von seiner bisherigen daseinsversorgenden und vormundschaftlichen rundfunkrechtlichen Rechtsprechung verabschieden müssen, womit es zur geforderten und wie dargelegt erforderlichen >>Entschlackung des Rundfunkbegriffs<< kommen wird." (Spindler in Rossnagel 1999: 2/ 29)
Endnote 21: Praktisch müsste man für diese Abschätzung jede E-Mail-Adresse versuchen einzuordnen und zu bewerten, ob sie für eine einzelne Person oder für einen weiteren Mailverteiler, den man zu überprüfen hätte, steht. Darüberhinaus müssen zumindest stichprobenartig auch die auf einzelne Personen hinweisenden Adressen überprüft werden, da prinzipiell hinter jeder Adresse ein Automat, der E-Mails beliebig weiterverteilt, stecken könnte. Dann stellt sich die Frage, wie groß der Quotient zwischen den Personen-Mailadressen und den vermuteten Mailverteiler-Mailadressen ausfallen muß, bevor abschliessend die rechtliche Zuordnung der Mailinglist vorgenommen würde. Im Prinzip könnte ja schon eine einzige Adresse ausreichen, von der man nicht erfährt, in welchem Umfang Beiträge an eine unbekannte Gruppe an Mitgliedern weitergeleitet werden. Vermutlich werden sich offen zugängliche, umfangreiche Mailinglists tendentiell in Richtung Mediendienste entwickeln. - zurück -
Endnote 22: Die meisten Mailinglist-Serverprogramme bieten den Befehl who an, mit dem die Mitglieder die Liste der Mitgliedermailadressen abrufen dürfen. - zurück -
Endnote 23: Das Mehraugen-Prinzip kann z.B. dadurch eingehalten werden, indem der System-Administrator nur einen Teil eines Passworts kennt, und der Personalvertreter oder Vorgesetzte den zweiten Teil eines Passworts, so dass fortan der Sysadmin nur unter Aufsicht agieren kann. Das Betriebssystem AIX unterscheidet bereits auf der technischen Kernelebene System-Administrator-Funktionen. So ist ein Administrator nur für die Vergabe von Zugriffsrechten an Daten und Programmen zuständig, dem anderen Administrator ist allein die Installation und Konfiguration von Programmen und Verzeichnissen erlaubt. Eine ähnliche Unterscheidung zur Einschränkung der operativen Macht kann man, zumindest als Überlegung, auch im Bereich der Mailinglist-Verwaltung finden. In der Dokumentation des Mailinglist-Programms Majordomo ist für eine zukünftige Version neben einem "Group-God", der eine Gruppe von Mailinglists betreut, auch ein Befehls-Verwalter vorgesehen, der Zugriff nur auf bestimmte Befehle hat, und ein davon zu unterscheidender Variablen-Verwalter, dem allein der Zugriff auf eine beschränkte Menge an Konfigurationsvariablen erlaubt sein soll. - zurück -
Endnote 24: In einigen Fällen wird darüberhinaus ein Vertrag über die Nutzungsbedingungen der Mailinglist ganz konventionell auf Papier abgeschlossen. - zurück -
Endnote 25: Der Betrieb einer Mailinglist ist, abgesehen von absoluten Hightraffic-Lists, keine Frage des Geldes. Jede inaktuelle Linux-Distribution, deren Software auf einem ausrangierten 486er läuft, bringt dafür die Programme mit. Zum Austausch von E-Mail reicht eine uucp-Verbindung an das Internet (vgl. Kirchdörfer et al. 1997). - zurück -
3 Die Bedeutung von Mailinglists für die Wissenschaftsöffentlichkeit
- 3.1 Die Fortsetzung des Projekts der Industrialisierung
- 3.2 Die Industrialisierung der Wissenschaftsorganisationen
- 3.3 Die Schwächen von Mailinglist-Diskursen und deren mögliche Behebung
Die Nutzung einer Mailinglist als wissenschaftliches Diskursforum weist, im Vergleich zu den traditionellen Verbreitungsmedien, für wissenschaftliche Kommunikation eine ganze Reihe an Vorteilen auf.(Endnote 1)
Neben den demokratietheoretisch guten Bedingungen für eine faire Teilhabe aller Mitglieder - schließlich ist die Trennung in Autoren und Leser in Mailinglists nicht durch die Verfügungsgewalt über teure Produktionstechniken und Distributionskanäle wie bei Zeitschriften und Büchern erzwungen, sondern das Ergebnis einzig des kommunikativen Verlaufs bzw. der Selbstorganisation des Forums - diffundieren Mailinglist-Beiträge, im Vergleich zu Symposienreferaten oder Fachzeitschriftsartikel, zu geringen Einrichtungs-, Verwaltungs-, Bewerbungs- und Nutzungskosten, weltweit mit einer unüberbietbar hohen Geschwindigkeit. Diskussionsteilnehmer ist es zudem möglich, nicht simultan zu einem bestimmten Zeitpunkt der Diskussion gemeinsam anwesend sein zu müssen oder in eins zu fallen mit derjenigen Person, für deren positionelle Inszenierung sie sich entscheiden (Stichwort: Identitätsmanagement) (vgl. Köhntopp 2000).
Beiträge asynchroner Foren bilden eine Zwischenform zwischen verschriftlichten Beiträgen, die weitgehend selbsttätig von einem Autoren ausgearbeitet wurden, und dialogischen Beiträgen, mit denen unmittelbar auf den Beitrag des Vorredners geantwortet wird. Ungeübte Teilnehmer haben anfangs oft Schwierigkeiten damit, diese Zwischenform zu treffen und tendieren zunächst zu einer der beiden, ihnen bekannten Formen. Ein Autor eines Mailinglistbeitrags hat mehr Zeit zur Formulierung als ein sich spontan entschieden habender Redner, weshalb das Reflexions- und Argumentationsniveau höher ist und mehr als nur kurze Einwürfe, Argumentationsbruchstücke oder gut abgehangene, weil alte Reflexionen geliefert werden können. Im Vergleich zu einem Aufsatz wiederum kann sich der Mailinglistteilnehmer nicht viel Zeit dafür nehmen, den eigenen Beitrag durch eine ausladende, traditionell erörternde Diskurssimulation zu immunisieren. Er benähme sich dadurch des einzigen Lohns, den eine Mailinglist zu bieten hat, nämlich dass sein Beitrag in einem weiteren Beitrag aufgegriffen und kommentiert wird. Die traditionelle Form des Aufsatzes ist, trotz aller gegenteiligen wissenschaftstheoretischen Programmatik, darauf angelegt, einen Diskurs, der andere als positive Bezugnahmen ermöglichte, eher zu verhindern anstatt, wie es wissenschaftstheoretisch gefordert ist, zu befördern. Dem empirischen Teil dieser Studie ist zu entnehmen, dass eine vollentwickelte Mailinglist-Diskussion im Durchschnitt sechs Tage nach dem ersten Initiativbeitrag beendet ist.
Diese oft genannten Vorteile von Mailinglists liegen auf der Hand. Inzwischen stellen sich einige Autoren im Hinblick auf die soziale Organisation elektronischer Verbreitungsmedien genauer nachhakend die Frage, wie demokratisch verfaßt es tatsächlich zugehen kann, wenn etwa die Teilhabe an elektronischen Diskussionsforen, im Hinblick auf die technische Infrastruktur als teuer, die Authentizität der Teilnehmer als unsicher und allein das Wissen um die angemessene Nutzung als doch zu voraussetzungsvoll beurteilt wird (vgl. Buchstein 1996; Hagen 1997; Leggewie/ Maar 1998; Rilling 1996; Roesler 1997; Stegbauer/ Rausch 1999; Westermayer 1998).
Auch auf der inhaltlichen Ebene wird speziell mailinglistgestützte Wissenschaftskommunikation vielfach skeptisch beurteilt. Ich möchte als Beispiel einige Äußerungen von Miller-Kipp/ Neuenhausen aufgreifen, weil diese meiner Ansicht nach auf eine typische Weise die ungebrochen traditionelle Sicht auf die Nutzung von Mailinglists zeigen (Miller-Kipp/ Neuenhausen 1999), die sich in ähnlicher Form zu einem Teil auch bei den zuvor genannten Autoren feststellen läßt. Die Autorinnen ziehen in ihrer Untersuchung über den pädagogischen Diskurs im Internet, in der sie eine ganze Reihe an englischsprachigen, auf Pädagogik Bezug nehmende Mailinglists untersuchten, das folgende Fazit:
"Die erhobenen Diskursqualitäten zusammenfassend, bestimmen wir den pädagogischen Diskurs im Internet via offene Diskussionsforen als praxisbezogene nachdenkliche Rede - über Erziehung. Dies ist er aber nur zur Hälfte. Zur anderen Hälfte ist er schlicht informatives Tagesgeschäft. Die nachdenkliche Rede, der 'echte Diskurs' ist potentiell global und interdisziplinär, wird tatsächlich aber us-amerikanisch dominiert und innerdisziplinär resp. fachlich bestritten. Sie, die gemeinte Rede, verteilt - potentiell global - vorhandenes pädagogisches Wissen und vorhandene pädagogische Erfahrung, baut aber kein neues Wissen auf, das dem Anspruch von Gewißheit genügte, und verdichtet Erfahrung nicht dazu. Sie ist im Blick auf die Subjekte authentisch, doch im Blick auf die Aussage nach wissenschaftlichem Maßstab ungeprüft. (...) Mit den entsprechenden Leistungen und der Funktion des etablierten Diskurses in der Erziehungswissenschaft, wie er über ihre Disziplinorgane läuft, kann der beobachtete Netz-Diskurs nicht konkurrieren. Verglichen mit ihnen, (ver)führt er in individueller Nutzerperspektive zum Verharren in der Praxis, in kollektiver Perspektive zum Verlust an Theorie. Er brächte, in Konkurenz gesetzt, eine Abnahme wissenschaftlicher Kompetenz sowohl hinsichtlich der Erarbeitung als auch der Bearbeitung mit sich." (Miller-Kipp/ Neuenhausen 1999: 19f)
An diesem Beispiel möchte ich drei Aspekte herausgreifen und kommentieren.
- Dass der Diskurs in amerikanischen Mailinglists amerikanisch
dominiert wird, sollte nicht dem Medium Mailinglist als Schwäche
oder Nachteil angerechnet oder vielleicht sogar als amerikanischer
Diskursimperialismus ausgelegt werden. Selbstverständlich
interessieren sich Amerikaner auf amerikanisch für ihre
amerikanischen Themen, wenn deutsche, wissenschaftlich orientierte
Pädagogen offenbar nicht auf die Idee kommen, eigenständige,
deutschsprachige Mailinglists speziell für den Diskurs
wissenschaftlich orientierter Pädagogen einzurichten. Das
für die Einrichtung notwendige Prozedere läßt sich auf
dem für die Netz-Versorgung wissenschaftlicher Institutionen
zuständigen Server des DFN (Deutsches Forschungsnetz) erfahren.
- Wichtiger noch: Die spezifische Funktion eines wissenschaftlichen
Diskurses besteht ganz allgemein darin, dass dieser für kurze
Zeit eine Form der Gewißheit durch flüchtiges, prinzipiell
offenes Infragestellen und Spekulieren erhöht - und nicht durch
gebethaft anhaltendes Wiederholen des bereits Gewußten. Dieses
flüchtige Moment gilt auch für Lehrbücher, die nur
deshalb zeitweise Halt geben mögen und als dem Diskurs entzogen
wahrgenommen werden, weil ihre Update-Zyklen länger währen.
Tatsächlich ist ein Lehrbuch zum Zeitpunkt des Erscheinens
produktionsbedingt zu einem guten Anteil bereits veraltet - und allein
deshalb diskursbedürftig. Mit einer soziologischen Axiomatik
betrachtet, ist es der Diskurs selbst, der prüft - wenn auch aus
Mangel an technischen Möglichkeiten bislang durch einige
reputierliche Diskursexperten, die, ungeachtet ihrer zumeist
gänzlich anderen Selbstwahrnehmung der
"Subjekthaftigkeit" dieses Geschehens, als Anwälte des
allgemeinen Diskurses der Scientific Community ihre Lehrbücher,
Aufsätze oder Gutachten schreiben. In Form von Mailinglists (oder
deren Nachfolgern) wird die Möglichkeit zur Beteiligung an diesen
Bewertungen nun zumindest der Tendenz nach demokratisiert. Diskurse in
Mailinglists offenbaren, wie mühsam tatsächlich
geführte Diskurse einzuüben, zu führen und zu verwalten
sind. Und zwar nicht nur mündliche, von denen man das ohnehin
weiß, sondern auch schriftliche.(Endnote 2)
- Die obige Kritik an den von ihnen untersuchten Mailinglists
trifft insofern nicht zu, weil sie generell auf Diskurse nicht
zutrifft. Aus meiner Sicht offenbart sich eine Geringschätzung
der Funktion real stattfindender Diskurse - vermutlich perfekt
entgegen den Intentionen der Autorinnen. Elektronisch gestützte,
wissenschaftliche Diskurse führen, auch in der jetzt schon
vorliegenden, institutionell in der Regel nur schwach gestützten
Form der Mailinglists, zu einer Zunahme wissenschaftlicher
Kompetenzen, weil reale, öffentliche Diskurse, und damit
Wahrheitstests, nicht nur in Form von Erörterungen simuliert,
sondern unter Teilnahme der Autoren tatsächlich geführt
werden.
Risiken und Konflikte im Umgang mit elektronischen Kommunikationsforen sind weder psychologisierend den Anwendern noch magisierend der Technik anzulasten, sondern der selten als Problem angeführten, überwiegend zunftartigen Form der Wissenschaftsorganisationen, in die elektronische Foren sich nicht umstandslos einpassen. In elektronischen Diskursforen läßt sich technisch die Möglichkeit zur formal fairen Teilnahme aller Mitglieder erfüllen - mehr nicht, aber auch nicht weniger. Damit ist die maßgebliche Bedingung für die funktional eigensinnige Konditionierung wissenschaftlicher Kommunikation gegeben - und zwar gleichgültig, ob man die Formulierung dieser Bedingungen der Konsens-Theorie des kommunikativen Handelns (vgl. Habermas 1985) oder der Dissens-Theorie funktionaler Differenzierung (vgl. Luhmann 1997) entnimmt. Die unterkomplex-vormodernen Sozialverhältnisse der Wissenschaftsorganisationen legen gegenwärtig nur die Einnahme eines unverbindlich-spielerischen Modus der Teilnahme an Mailinglists nahe.
Bevor auf Aspekte der gegenwärtigen Wissenschaftsöffentlichkeit eingegangen wird, soll kurz die von mir seit längerem vertretene These von der bislang noch ausstehenden Industrialisierung der mit Mitteilungsverarbeitung als Produkt befaßten Organisationen, zu denen insbesondere die mit Wissenschaft befaßten zählen, eingeschoben werden.
3.1 Die Fortsetzung des Projekts der Industrialisierung
Das Internet erzeugt einen Entwicklungsdruck, unter den derzeit sämtliche Organisationen dieser Welt geraten sind, weil sie in einen Wettlauf um eine möglichst intelligente Informationsverarbeitung gezwungen werden. Organisationen müssen das Call-Center-Problem lösen, wie mit den Faxen, Briefen, Telefonaten und E-Mails möglichst standardisiert (Stichwort "Unified Messaging") umzugehen ist. Hierbei gilt, die Mitteilungen von Partnern, Kunden und gefährlichen Konkurrenten mit hoher Trennschärfe von den uninteressanten Störungen zu unterscheiden und selbst Mitteilungen zu erzeugen, die andere nicht ignorieren sollen. Die Funktion von Call-Centern besteht insofern darin, den externen Signal-Rauschabstand von Organisationen zu trimmen, indem sie als Synchron-Asynchronumsetzer operieren: Ein guter Signal-Rauschabstand bedeutet, dass Anfragen von außen möglichst sofort wiederum nach Draussen als "akzeptiert/ nicht-akzeptiert" signalisiert und in die interne Kommunikation als "auf eine bestimmte Weise zu bearbeiten" eingepasst werden. Eine Organisation muss hier Formen finden, wie sie das Wissen ihres personalen Inventars optimal mehrt, adressierbar macht und abzapft.(Endnote 3)
Diese externen und internen Anforderungen verändern die Formen der internen Kommunikationen der Organisationen wie auch die Formen der Arbeitsteilung unter den Mitgliedern der Organisation, die Formen der neu zu bändigenden Konflikte und die Formen des Selbstverständnisses des personalen Inventars der Organisationen. Sobald beispielsweise den Mitgliedern einer Organisation E-Mail zur Verfügung steht, lassen sich unterschiedliche Grade des Informierens bzw. Informiertwerdens nicht, wie bisher fadenscheinig aber konfliktlösend, beispielsweise mit einem unzulänglichen Umlaufmappenverfahren über eine Registratur begründen, sondern nur mit den unterschiedlichen Positionen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Außerdem führt die elektronisch gestützte Zusammenarbeit zwischen Abteilungen oftmals dazu, abteilungs- oder organisationsübergreifende Projektgruppen zu bilden, die sich im alten Organisationsgefüge formal nur schwach absichern lassen, ihrerseits aber trotzdem, um der gesteigerten Produktivität willen, zuverlässig adressabel sein müssen. Die breite Verwendung von E-Mail reaktiviert zunächst einmal das durch Routinen stillgelegte Konfliktpotential von Organisationen und schafft neue (frühzeitig beobachtet und beschrieben z.B. bei Zuboff 1988).
Es ist daran zu erinnern, dass Organisationen insbesondere zu Beginn der Industrialisierung in sehr kurzer Zeit, gründlich und von selbstaufklärenden Versuchen begleitet, durch den Einsatz von Technik strukturell durchgeschüttelt wurden. Karl Marx analysierte im 13. Kapitel des 1867 das erste Mal publizierten 1. Band des Kapitals die gesellschaftlichen Auswirkungen von Dampfmaschine und Werkzeugmaschine, die ihrerseits als Folgen und Auswirkungen gesellschaftlicher Entwicklungen ausgewiesen wurden (vgl. Marx 1976). Marx zeigte darin, wie der Einsatz moderner Maschinen die Zünfte und Manufakturen veränderte, dadurch dass riesige Fabrikareale entstanden, in denen große Mengen an Menschen arbeitsteilig und zum großen Teil maschinenvermittelt stetig zusammenarbeiteten. Diese Umgebungen wirkten wiederum auf die allgemein anzutreffenden Organisationsformen und die gesellschaftlichen Formationen weltweit als auch auf die Psychen der Menschen zurück. Speziell in seinen soziotechnischen Analysen befand Marx sich damit auf der Höhe seiner Zeit, zumal er die bis heute noch namhaften Technologen Babbage und Ure als Gewährsmänner herangezogen hatte (vgl. Müller 1981).
Allerdings verfügte Marx über keine, seinem sonstigen Niveau angemessene, theoretische Positionierung des Transmissionsriemens, wie es damals hieß. Man konnte zu seiner Zeit im Transmissionsriemen und den dazugehörigen Umlenkvorrichtungen wenig mehr als eine Verlängerung der Dampfmaschine, deren Kraft mittels Riemen und Umlenkrollen weitergeleitet wurde, sehen. Aus der heutigen, kybernetisch instruierten Sicht ist am Transmissionsriemen nicht so sehr die Eigenschaft der effizienten Energieübertragung relevant, sondern mehr noch die Möglichkeit des kontrollierten Koppelns von Einzelmaschinen zu einer Gesamtmaschinerie. Statt der Übertragung von Energie, die den Transmissionsriemen analytisch tatsächlich nur zu einem trivialen Anhängsel der Energiemaschine werden liesse, ist die maschinelle Kontrolle bzw. Steuerung der Energiezufuhr das zentrale Funktionselement. Der Transmissionsriemen funktioniert jedoch dann von der Energiemaschine funktional gelöst, wenn der Riemen über automatisierte Sensorik- und Steuerungsleistungen verfügt.
Meine basale Annahme lautet nun, dass Computernetze wie das Internet die Funktion eines weltumspannenden generalisierten Transmissionsriemens erfüllen. Computernetze lassen sich damit umstandslos in die Tradition des Industrialisierungsprojekts stellen: Sie katalysieren Veränderungen in Sozialsystemen, insbesondere in Organisatioen. Netze stehen in dieser Tradition und brechen mit dieser, indem sie sie durch die bislang ausgebliebene und nunmehr ingang gesetzte automatisierte Vernetzung gesellschaftlicher Mitteilungsverarbeitungen vollenden. Diese generalisierte Kopplungsfunktion mittels Computernetzen rundet technisch eine Entwicklung ab, die mit dem Stromgenerator bzw. dem Elektromotor und den Verbindungskabeln vereint im Stromnetz als einem großtechnischen System einsetzte.
Eine Umstellung von Handwerks- auf Industrieproduktion läßt sich sowohl zu Beginn der Industriellen Revolution als auch heute an der plötzlich einsetzenden starken Nutzung vernetzter Maschinen ablesen, die Menschen in ihrer Arbeit unterstützen oder ersetzen. Der bloße Maschineneinsatz oder die Größe der Maschinen, man denke nur an Schiffe oder Windmühlen, die es lange schon vor der industriellen Revolution gab, reichen zur Charakterisierung industrieller Produktion allein nicht hin. Als systematisches Kriterium liegt der technischen Umstellung auf Industrieproduktion generell die Reproduzierbarkeit von Maschinen durch Maschinen zugrunde (Anders 1980). Durch die Selbstbezugnahme von Maschinen auf Maschinen sind diese genau nicht nur als große, letztlich doch irgendwie von Menschen geführte Werkzeuge zu verstehen(Endnote 4) , sondern mit ihnen entsteht eine technische Realität sui generis, die ihre eigenspezifizierten technischen Formen mit eigensinnigen Störungen sozialer Systeme hervorbringt.
Die maschinelle (und damit "eigensinnige") Reproduktion von Maschinen aus Maschinen setzte spätestens mit der Nutzung der Wattschen Dampfmaschine ein(Endnote 5) , die gegen Ende des 18. Jahrhunderts als generalisierte, von engen Raum- und Zeitvorgaben gelöste "Energiemaschine" zur Verfügung stand. Erst mit der Anwendung der spezifischen Leistungsfähigkeit der Dampfmaschine auf sich selber schuf sie die Voraussetzungen zur eigenen Wandlung von einer überwiegenden Holz-, zu einer Holz-Eisen-, zu einer Metallkonstruktion, was jeweils mit einer deutlichen Wirkungsgradsteigerung und einer Flexibilisierung der Raum-/ Zeitstellenfixiertheit der Maschine einherging, die wiederum eine Bedingung für das Entstehen von Maschinenvernetzungen war.(Endnote 6) Diese Technisierung der Produktion lief parallel zur Umstellung der Organisation der Produktion. Aus vielen zunftartig verfaßten Manufakturen und Handwerksbetrieben wurden bekanntlich Fabriken mit einem hohen Grad an Standardisierung der Abläufe, Arbeitsteilung und Automatisierung.
Techniksoziologisch lassen Computer sich sowohl als kommunikativ rauschfreies Medium als auch als Maschinen, die auf ihre eigenständige Weise Kommunikationen bearbeiten, ausweisen (vgl. Esposito 1993).(Endnote 7) Diese für den Computer gültige Doppelseite gilt in ungleich stärkerem Maße auch für Computernetze. Im Unterschied zu Werkzeugen, die ihre Gegenstände entlang von Ursache-Wirkung-Ursacheverkettungen zu beobachten gestatten, sowie von Maschinen, deren Funktionsprinzip aus ineinander verschränkten Regelkreisen besteht (vgl. Bamme et al. 1983), läßt sich das Spezifikum großtechnischer Systeme in der Form ihrer Adressierungen und Operationen, knapp gefaßt als Protokolle, ausweisen (vgl. Rost 1997). In Computernetzen kommt es zu einer eigenständigen Bearbeitungsform von Kommunikationen nicht nur im Modus von Computer-Maschinen, sondern im Modus eines großtechnischen Systems als "Medium und Maschinerie". Der Begriff "Protokoll" reagiert dabei auf den in die allgemeine Soziologie neu eingeführten Grundbegriff der "Adressibilität" (Fuchs 1997).
Unter einem Protokoll versteht man, allgemein ausgedrückt, ein Set an Operationen, mit denen Daten - damit sind soziologisch gewendet "verschriftlichte Sinneinheiten" gemeint - an Adressen angedockt und dann systemspezifisch prozessiert werden. Adressen funktionieren dabei nur als Markierungen für Kontaktpunkte verschiedener Systeme, noch ohne Bezug auf deren operative Seite.(Endnote 8) Konkret gewendet: Jedes Markup in einem Dokument ist eine Adressen, an der kontrollierte Operationen mit Daten durchgeführt werden.
Eine solche Adressierbarkeit kann man sich anhand der Strukur eines Buches klarmachen: Eine Überschrift, ein Inhaltsverzeichnis, ein alphabetisch sortiertes Register, ein Verweis in einer Fußnote, der Titel eines Buches und der Autorname sind jeweils Beispiele für Adressen innerhalb eines Buchtextes, die bestimmte Verfahrensweisen der solcher Art bezeichneten Daten nahelegen. Das spezifisch-besondere eines großtechnischen Systems wie dem Internet liegt darin, daß solche Adressen in elektronisch zugänglichen Dokumenten zusätzlich auch technisch eigendynamisch gesetzt, verwaltet und auch wieder gelöscht werden in einem sehr viel größeren Ausmaß, als dies bislang auf Papier möglich war. Markups entsprechen hiernach Adressen, die als Kontaktpunkte für Links im weitesten Sinne fungieren. Diese Kontaktpunkte bestehen zwischen den Autoren, die solche Dokumente erstellen und verarbeiten, den sozialen Systemen, die solche Dokumente als bestimmte Kommunikationen prozessual über bestimmte Regeln konditioniert aneinanderschließen, und der Kommunikationstechnik, die solche Dokumente medial-technisch zugänglich macht und aneinanderschließt sowie maschinell verarbeitet.
Der Begriff Protokoll gestattet insofern, den funktionalen Aspekt der Netze zu erfassen und die gern und viel verwendeten Metaphern zur Analyse des Internet, wie beispielsweise "gesellschaftlicher Informationsraum" (Baukrowitz/ Boes 1996) oder "Kommunikationsraum" (Stegbauer/ Rausch 1999), deren Raumvorstellungen sich am unterkomplexen Paradigma des "Behälters" orientieren (vgl. Paetau 1997), abzulösen. Nicht die Letztkopplung an einen bestimmten Raum ist für das Internet funktional charakteristisch, sondern die "selbsttragende", operativ zugängliche Verschränkung von Adressen.
Auf dem generalisierten Transmissionsriemen Internet können sich dank dessen fein granulierter Adressierbarkeit Steuerungsanweisungen bei Bedarf weltweit in wenigen Sekunden automatisiert ausbreiten. Auf der protokolltechnischen Repräsentationsstufe der Steueranweisungen operieren die sogenannten Routing-Protokolle wie beispielsweise RIPE. RIPE dient dazu, Routingtabellen, über die das selbstorganisierte Zustellen von Datenpäckchen geschieht, verschiedener Netzcomputer automatisch auf den neuesten Stand abzugleichen. Dies muss automatisiert erfolgen, weil es unmöglich ist, dass menschliche Beobachter Tabellen pflegen, die Umleitungen enthalten, sobald Netzcomputer kurzzeitig ausgeschaltet werden oder Subnetze gestört sind oder ausfallen. Auf diese Weise ist das Internet, im Unterschied zu einer Maschine, in einem bemerkenswerten Ausmaß in der Lage, sich auf funktionaler Ebene selbst zu reparieren. Diese weitestgehend automatisierten Steuerungsanweisungen erlauben dann auf höheren OSI-Schichten stabile, wechselseitige, verschriftlichte Kommunikationen, die ihrerseits automatisiert aufeinander zugreifen können (zu OSI vgl. Tanenbaum 1990). Dies ist in Bezug auf wissenschaftliche Kommunikation, also vornehmlich im Medium von Texten, dann möglich, wenn Texte strukturell maschinengerecht vorliegen. Und das heißt vor allem, dass sie in standardisierter Form beispielsweise mit Hilfe von Dateiformaten wie der Standard Generalized Markup Language (SGML) (vgl. Vint 1998) oder eXtensible Markup Language (XML) (vgl. Behme/ Mintert 1999) oder einer erst noch auszuarbeitenden Diskurs-Markup-Language (DML) (vgl. Rost 1996c) vorliegen sollten. Auf Papier lassen sich diese strukturellen Zusätze, die Texte maschinenbeobachtbar machen, so dass Texte automatisiert-eigensinnig Kontakt zueinander aufnehmen können, so dass daraus weitere Textcorpora entstehen, praktisch nicht realisieren. Um es anschaulich auszudrücken: Es bedurfte zur faktisch-operativen Verselbständigung von Texten der Herausbildung der dritten maschinellen Dimension, die sozusagen senkrecht zum Papier steht.
Diese durch das Internet ermöglichte automatisierte Zugänglichkeit von Texten für Maschinen ist das hervorzuhebende Merkmal: Obwohl einzelne Computer im Netz ohne menschlich-semantische Intelligenz als triviale Syntaxmaschinen operieren, können sie im technisierten Netzverbund die Kommunikationen von Beobachtern (im Unterschied zu deren unzugänglichen Mentalzuständen) verarbeiten und ihrerseits Kommunikationen auf eine solche Weise anstoßen, dass sie für menschliche Beobachter einen Sinngewinn abwerfen oder andere Maschinen ihrerseits zu Aktionen veranlassen. Dieser Aspekt der Interoperationalität spielt im Zuge der Industrialisierung der auf reflexive Mitteilungsverarbeitung spezialisierten gesellschaftlichen Formationen eine enorme Rolle. Zwischen Mensch und Text drängen sich zunehmend deren Leistungsfähigkeiten steigernden Maschinen. Ein Text wird dann auch semantisch nur noch mittelbar verarbeitet, nämlich unter Nutzung der von Rechnern erzeugten semantischen Alternativen.
Als aktuelle Beispiele für den von Maschinen provozierten Sinngewinn lassen sich Suchmaschinen wie Altavista, Google oder Metacrawler anführen (vgl. Köhntopp 1997) oder, schon avancierter, Personal Agents, die Menschen im Umgang mit dem Netz assistieren (vgl. Helmers/ Hoffmann 1996; Wagner 1997) und Workflow- oder Groupware-Applikationen, die Teams führen (Burger 1997; Jablonski et al. 1997).(Endnote 9)
Organisationen, die sich auf die Steuerungsleistungen des Internet einlassen und die ihre Maschinen und ihr Personal zunehmend flexibler, beispielsweise durch Workflow- oder intelligente Content-Managementsysteme permanent änderbar zusammenbinden, verändern sich - und nicht zuletzt auch das Selbstverständnis ihres Personals - gründlich. Diese Änderungen treffen vor allem diejenigen Organisationen hart, die bislang unter weitgehend nicht-industrialisierten Bedingungen produzierten wie beispielsweise Hochschulen und Institute, Verlage, Verwaltungen, politische Institutionen, Management-Abteilungen.
Auf Basis des Internet entsteht ein generalisierter "Druck", dass Kommunikationen füreinander weitgehend automatisiert adressabel werden. Diese automatisierbare Adressabilität, die Entwicklung von Protokollen, die verschiedene Repräsentationsformen insbesondere von Texten auf verschiedenen Systemebenen operativ zugänglich halten, ist die maßgebliche technische Voraussetzung für die Industrialisierung des Wissenschaftsbetriebs. Nachfolgend möchte ich mich auf die Industrialisierung der Wissenschaftsorganisationen konzentrieren, auf die das Internet, durchaus in dessen kleinformatigen Inkarnation als Mailinglist, eine katalytische Differenzierungswirkung ausübt.
3.2 Die Industrialisierung der Wissenschaftsorganisationen
"Mit Beharrlichkeit koexistieren Industrialisierung der Gesellschaft und handwerklich bleibende Intelligenzarbeit, die nirgends den Ansatz macht, die Stufe der großen Maschinerie und Kooperation zu erklimmen; das gilt für die in der Gesellschaft zerstreute unmittelbare Intelligenzarbeit der Produzenten ebenso wie für die berufliche. In der Industrieproduktion wird zwar die Intelligenztätigkeit angewendet, sie steckt ja bereits in der toten Arbeit (...). Sogleich zieht sie sich aber auf die handwerkliche Stufe wieder zurück." (Negt/ Kluge 1981: 442)
An diesem unterdessen gut abgehangenen Befund von Negt/ Kluge knüpfe ich mit der Behauptung an, dass sich durch die Nutzung des Internet gesellschaftsweit die mit Mitteilungsverarbeitung befaßten Organisationen, unter ihnen insbesondere Wissenschaftsinstitutionen, anschicken, ihre bislang zunftartig-handwerkliche Organisationsstufe wissenschaftlicher Produktion zu verlassen und ein industrialisiertes Niveau zu erreichen. Damit passen sie sich einem Produktionsniveau an, das die mit "Materialverarbeitung" befaßten Organisationen (bzw. Organisationsteile) in der Regel, aufgrund der ungleich leichteren Algorithmisierbarkeit ihrer Tätigkeitsfelder, früher erreicht haben.
Diese These von der Fortsetzung des Industrialisierungsprojekts durch den breiten Einsatz von Computern (vgl. Lutz 1990; Steinmüller 1993) ist so wenig neu wie die These von der computergestützten Industrialisierung der Wissenschaft (vgl. Hack/ Hack 1985; Halfmann 1994). Diese These gewinnt allein dadurch an Plausibilität, weil der finanzielle und personale Anteil an Forschung und Entwicklung in der Industrie um ein Mehrfach größer ist als der durch Hochschulen organisierte, wie Matthias Wingens vor kurzem nachwies (vgl. Wingens 1998). Die von Wingens' entwickelte These von der Industrialisierung der Wissenschaft läuft darauf hinaus, dass nicht nur die industrielle Produktion seit etwa Mitte der 19. Jahrhunderts verwissenschaftlicht wurde (Stichwort: Taylorismus), sondern dass auch umgekehrt ein relevanter Anteil von Wissenschaft in den Betrieben industrialisiert betrieben werde.
Aus meiner Sicht lässt sich ein sehr viel stärkerer Begründungszusammenhang für die Industrialisierungsthese entwickeln, wenn man an den Produktionsbedingungen von Wissenschaft selbst ansetzt. Dabei gilt zunächst einmal, Forschung von Wissenschaft zu unterscheiden. Wissenschaft zeichnet sich wissenschaftstheoretisch dadurch aus, dass sie auf den Diskurs als Korrektiv unabdingbar angewiesen ist. Forschung dagegen läßt sich durch Wissenschaft inspirieren, setzt aber statt auf Diskurse innerhalb der Scientific Community auf andere Korrektive (wie persönliche Karrierekalküle, marktpolitische Strategien oder politisch motivierte Strategien zur Entwicklung technischer Infrastrukturen). In Unternehmen muss ein strategisch unkontrolliertes Abfliessen von Forschungsergebnissen gefürchtet sein, weil die von Unternehmen intern organisierte Forschung zwecks Erlangung von Pioniergewinnen auf die möglichst exklusive Entwicklung neuer, marktfähiger Produkte zielen muss. Kapitalmarkt- und nicht Diskursfähigkeit entscheidet hier über die Qualität der geleisteten Forschung. Aus Forschung kann jedoch Wissenschaft werden von dem Moment an, von dem an das Erforschte publiziert und dadurch dem wissenschaftlichen Diskurs ausgesetzt wird. Die Behauptung von der "Industrialisierung der Wissenschaft" sollte deshalb zum einen von einer in industrialisierten Umgebungen etwaig industriell betriebenen Forschung unterschieden und zum anderen auf die Produktionsbedingungen wissenschaftlicher Diskurse bezogen werden.
Und auch die Formulierung von der "Industrialisierung der Wissenschaft" ist genauer zuzuspitzen. Die Produktionsbedingungen wissenschaftlicher Diskurse werden durch Wissenschaftsorganisationen festgelegt, weshalb die Rede von der "Industrialisierung d e r Wissenschaft" auf die "Industrialisierung der diskursorientierten Wissenschaftsorganisationen" enggeführt werden sollte. Als Wissenschaftsorganisationen sind insbesondere die Hochschulen, die Hochschulinstitute, die Kulturbehörden, die über die Besetzung von Lehrstühlen entscheiden (und darüber Einfluß auf wissenschaftliche Diskurse nehmen), sowie die Verlage für wissenschaftliche Aufsätze und Bücher zu nennen.
Die Formulierung von der "Industrialisierung" zur Kennzeichnung gesellschaftlicher Entwicklungen, ist zweifellos problematisierbar, zumal sich die Soziologie schon lange um die Formulierung von Gesellschaftskonzepten bemüht, die nicht mehr im "Dunstkreis" von Industrie stehen.(Endnote 10) . Diese Konzepte konzentrieren sich auf einen Aspekt und stellen diesen besonders klar heraus. Dadurch gewinnen sie den Vorteil, dass sie die daran anschliessende Begriffsentwicklung vergleichsweise gut kontrollieren können. Im Begriff der Industrialisierung, oder gar der Industriegesellschaft, sind im Vergleich dazu viele heterogene Aspekte zusammengezogen: Technik, Organisation, Gesellschaft, Politökonomie, Arbeit, ... Die traditionelle Rede von der "Industrialisierung" läuft deshalb Gefahr, die inzwischen als eigensinnig operierend ausgewiesenen Systeme zu schlicht kurzzuschliessen. Sie zielt eher auf die Formulierung von Notwendigkeiten als auf den Ausweis von Alternativen.
Trotz dieser Einwände läßt sich am Begriff der "Industrialisierung" festhalten, weil er im Hinblick auf die Möglichkeiten zur Öffnung als auch zur Engführung von theoretischen Phantasien noch nicht hinreichend ausgereizt und zu früh fallengelassen wurde (vgl. dazu Pirker/ Müller/ Winkelmann 1987), ohne zumindest testweise Bezüge zum Internet herzustellen. Das Internet gelangte so gesehen etwas zu spät auf die theoretischen Monitore. Allerdings gilt es zu beachten, ihn nicht als generalisierenden, gesellschaftstheoretischen Begriff (Industriegesellschaft) einzuführen, sondern bescheiden nur zur Beobachtung von Veränderungen in Organisationen in Bezug auf Arrangements zwischen Strukturen der Kommunikation, der Arbeitsorganisation, des Technikeinsatzes und der Personkonzepte zu nutzen. Der Begriff "Industrialisierung" fokussiert traditionellerweise insbesondere auf die Herausbildung von Standards, die sowohl organisatorische Verfahren als auch technische Abläufe betreffen, die wenn etabliert neue Aggregationen von algorithmisierten Vernetzungen ermöglichen. Und genau solche ausformulierten und praktisch umgesetzten Standards auf der Schnittstelle von Organisation und Technik, in der für das Internet traditionellen Form der RFC-Texte ("Request-For-Comments"), bilden die sozial-operative Grundlage für das Funktionieren des Internet.
Dass das Festhalten an dem Begriff der Industrialisierung, gerade unter den gegenwärtigen Bedingungen des Einflußes des Internet, lohnen kann, zeigt sich beispielsweise in der Beurteilung der beiden von Bell vorgelegten Merkmale einer "postindustriellen Gesellschaft". Bell hob als Merkmale der postindustriellen Gesellschaft "die zentrale Stellung des theoretischen Wissens und das zunehmende Übergewicht der Dienstleistungswirtschaft über die produzierende Wirtschaft" (Bell 1979: 13) hervor. Diese Merkmale taugen im Nachhinein betrachtet, insbesondere mit gesellschaftsanalytischem Ehrgeiz, wenig. Industrialisierung zeichnet sich generell durch eine hohe Bedeutung "theoretischen Wissens" aus, wenn man allein daran denkt, wie die parallel zur Industrialisierung laufende Alphabethisierung der Bevölkerung ingang kam.(Endnote 11) Und geradezu als ein Charakteristikum für die Spätphase der Industrialisierung läßt sich die sehr weit reichende Maschinisierung auch der "Dienstleistungswirtschaft" ausweisen. Dabei kann das Zählen von Beschäftigten, nach Sektoren geschieden, keinen Maßstab für die Bewertung irgendeines Übergewichts eines Sektors abgeben. In Folge der zunehmenden Maschinisierung von bislang gering technisierten Bereichen der Organisationen ist davon auszugehen, dass auch in diesen Bereichen in the long run der Anteil der Beschäftigten wieder zurückgehen wird.(Endnote 12) Bell rechnete offensichtlich nicht mit der Möglichkeit zur Industrialisierung auch von Dienstleistungen.(Endnote 13)
Was hat man sich unter industrialisierter wissenschaftlicher Produktion vorzustellen? Wissenschaftsorganisationen, die industrialisiert produzieren, zeichneten sich insbesondere durch vier Merkmale aus:
- Hochauflösende Standardisierungen der wissenschaftlichen
Kommunikationen,
- kontrollierte Arbeitsteilung zwischen Wissenschaftlern im
Hinblick auf die Erstellung, Verarbeitung und Distribution
wissenschaftlicher Publikationen,
- eine stark algorithmisierte Überformung dieser Arbeit,
- sowie eine stärker teamorientierte Selbstaufassung des
Personals.
Allgemeiner gesprochen soll Industrialisierung also einen Zusammenhang von Arbeitsorganisation, Technikeinsatz, standardisierter Kommunikation sowie einem spezifischen Selbstverständnis der beteiligten Personen in Organisationen bezeichnen.(Endnote 14)
Gegenwärtig produzieren die Wissenschaftsorganisationen im Ganzen noch immer vorindustriell. Die Sozialverhältnisse lassen sich überschlägig als zunftartig bezeichnen. Entsprechend gering ist die technische Unterstützung beim Führen, Auswerten und Ingangsetzen von Diskursen, entsprechend bieten stattdessen Status, Position und Reputation Orientierung. Und entsprechend ist nicht zuletzt auch die Selbstauffassung des Personals ausgebildet, mit strukturell weitgehend überschätzt-omnipotenten Meistern auf der einen und strukturell weitgehend irrelevanten Lehrlingen und Gesellen auf der anderen Seite.(Endnote 15)
Das "Produkt" der Wissenschaftsorganisationen besteht in der Kontrolle der Variation, Selektion und Stabilisierung wissenschaftlicher Diskursbeiträge. Für die traditionellen wissenschaftlichen Institutionen bemessen Redakteure, Lektoren, externe Gutachter und nicht zuletzt Berufungsausschüsse die Qualität von Wissenschaft und Wissenschaftlern anhand von Texten. Das Zustandekommen der Entscheidungen ist dabei allerdings undurchsichtig: Ein Text wird dann publiziert, nachdem ein anerkannter Experte oder eine anerkannte Gruppe von Experten über einen Text entschied und ihn eben anerkannte oder nicht, und dann zumeist Weisungen erteilt, wie der Text zu verbessern sei, damit er den allgemein erwarteten Qualitätsstandards entspräche. Bewertungsfilter wie diese sind funktional grundsätzlich unabdingbar, verfahrenstechnisch in der gegenwärtig etablierten Form aber nur deshalb akzeptabel, weil eine Vielzahl verschieden eingestellter Filter das Maß an Willkür im Einzelnen erträglich hält. Bei Bedarf weicht ein hartnäckiger Autor derzeit auf solche Filter aus, die seinen Beitrag durchlassen. Die allseits gewünschte Filterwirkung durch Begutachtungen ist für das Wissenschaftssystem damit jedoch zu einem guten Teil wieder aufgehoben: Es kann letztlich nicht nur jeder noch so banale Beitrag doch irgendwo publiziert werden, sondern es ist vor allem unmöglich, als Wissenschaftler tatsächlich einen Überblick zum aktuellen Stand der Diskussion in allen ihren Facetten und evolutionären Verästelungen zu erhalten. Man behilft sich deshalb allseits mit einer informellen, trotzdem in der Spitze weitgehend als konsistent wahrgenommenen, Reputationshierarchie an Fachverlagen, Hochschulen, Forschungsinstituten und Kollegen. So kritisch der wissenschaftliche Diskurs wissenschaftstheoretisch verfaßt sein soll, so vertrauensselig muss den Reputationsspitzenreitern Gefolgschaft geleistet werden, im Vertrauen allein auf die selbstregulative Wirksamkeit nicht der Diskurse, sondern der allseitigen Reputationskalküle. Zugleich muss jedoch eine kritisch-erörternde Zurückhaltung zumindest simuliert werden. Im Ergebnis wird der Anschluß von Kommunikationen an Kommunikationen über die Orientierung an der Reputation der Autoren und Organisationen konditioniert, nicht jedoch über die wissenschaftstheoretisch geforderten, demokratischen Entscheidungen einer Scientific Community.(Endnote 16)
Die Unterkomplexität der Wissenschaftsorganisationen läßt demokratische Verfahrensweisen nicht zu, weil faire Sichtungs- und Bewertungsverfahren, die nicht durch zwar funktionale, aber wissenschaftstheoretisch unzulässige politische oder pragmatisch-verfahrenstechnische Abkürzungen ersetzt sind, mit Papier als technisch-operativem Verbreitungsmedium viel zu viel Zeit kosteten. Die traditionellen Verfahren befestigen die Wiederkehr des immer Gleichen und deren darauf bezogenen Negationen, und immunisieren zugleich gegen das Andere.(Endnote 17)
Mailinglists sind in die etablierte akademische Reputationshierarchie nicht integriert, sie liegen außerhalb der Hierarchie. Die selbstverständlich anzutreffende informelle Anerkennung von gehaltvollen Mailinglist-Texten kluger Autoren trägt nichts zur deren Mehrung an Reputation in den traditionellen Wissenschaftsorganisationen und somit nichts zu deren existentiellen Sicherung bei. Weil die Mailinglist-Beiträge zu kleinformatig ausfallen und an keine Wissenschaftsinstitution adressiert sind, sprechen die etablierten Bewertungsfilter nicht an... weil diese Bewertungsfilter nicht ansprechen, fallen die Beiträge in Netzforen kleinformatig aus. Wissenschaftlich gehaltvolle Ideen in elektronische Foren zu setzen, heißt in dieser Sicht diese zu verschenken.
Das "Verschenken von Ideen" in Mailinglists können sich nicht nur diejenigen leisten, die ihrem Status gemäß nichts zu verlieren haben. Zu ihnen zählen Dilettanten, Hasardeure, Spieler, Studenten oder Privatgelehrte im Wortsinne. Das Verschenken können sich jedoch gerade auch diejenigen leisten, die entweder schon ein bischen gewonnen haben, weil sie beispielsweise Aufsätze in angesehenen, traditionellen Publikationsmedien veröffentlichten, oder die bereits alles gewonnen haben: Professoren. Die größten Probleme bei der Nutzung von Mailinglists hat der drängend-forschende Mittelbau, weil er sich am stärksten latent in Sorge befindet, innovative, noch nicht öffentlich abgestützte Thesen, die ihn gerade umtreiben, preiszugeben. Deshalb liegt für diesen mehr als für alle anderen Mitglieder eine abwartend-konsumtive Haltung nahe. Zugleich zeigt ein erfahrener Umgang mit einer Mailinglist, dass nur dann gehaltvolle Antworten zu erwarten sind, wenn schon die Fragen hinreichend gehaltvoll geformt wurden. Etwas anders formuliert: Eine funktionierende Mailinglist springt leicht nur dann im Modus einer Thesentest- und Thesengeneriermaschine an, wenn sie ihrerseits mit gehaltvollen Thesen gefüttert wird. Thesen schliessen systematisch besonders leicht an Thesen an. Wenn die Reproduktion von Thesen gelingt, decken funktionierende Mailinglists somit eine Lücke ab, die von den trivialen Faktenabrufmaschinen der Literaturdatenbanken und Suchmaschinen im Internet offengelassen wird. Die rein passiv abwartende Haltung gegenüber einer Mailinglist ist insofern suboptimal bzw. der Wirkungsgrad unter dem Aspekt der Aufmerksamkeitsökonomie (vgl. Rötzer 1998) eher schlecht, gerade wenn die Generierung frischer, öffnender Thesen für die eigene Arbeit ansteht.
Mailinglists bestehen insofern neben den etablierten Wissenschaftsdiskursmedien. Sie zeigen, trotz der gleich zu besprechenden strukturellen Schwächen, dass das Führen realer Diskurse tatsächlich möglich ist. Sie untergraben tendentiell das traditionelle Reputationsmodell, indem tatsächlich mit überraschenden Beobachtungen, originellen Argumenten und Gegenargumenten aufgewartet werden muss, wobei das Schweigen nicht als unergründliche Tiefe sogar reputationsförderlich, sondern schlicht als Sprach- besser Argumentationslosigkeit interpretatierbar wird. Mailinglists fangen zudem an, das Produktionsmodell von Wissenschaft zu verändern. So kann der Gesamtext einer Mailinglist oder die Entwicklung einer Argumentation keinem einzelnen Autoren mehr zugerechnet werden. Und nicht zuletzt sind Mailinglisttexte sowohl für Menschen als auch für Maschinen zugänglich. Texte geraten somit in ein Netz maschineller Adressierbarkeit - wenn auch auf einem zunächst noch rudimentären Niveau. Nicht zuletzt ermutigen Erfahrungen im Umgang mit Mailinglists womöglich zu neuen Formen e-mailgestützter Zusammenarbeit (vgl. Rost 1996b). Mailinglists führen insofern einen kleinen Schritt in Richtung der Industrialisierung des wissenschaftlichen Diskurses bzw. der Wissenschaftsorganisationen.(Endnote 18)
Dass insbesondere elektronische Foren alsbald im vollgültigen Maße auch für karriererelevante wissenschaftliche Diskurse verbindlich in Gebrauch genommen und die papierenen Verbreitungsmedien ablösen werden, scheint allgemein ausgemacht, denn zu stark wiegen insbesondere die operativen Vorteile eines elektronischen Verbreitungsmediums. Allerdings werden nicht nur bis dahin die strukturellen Schwächen von Mailinglists bzw. allgemeiner von elektronisch gestützten Diskursforen behoben sein müssen, die sich im Vergleich zum Papier nicht, sehr wohl aber im Vergleich zu den inhärenten Möglichkeiten abzeichnen.
3.3 Die Schwächen von Mailinglist-Diskursen und deren mögliche Behebung
Mailinglists weisen, in Bezug auf das Führen wissenschaftlicher Diskurse, drei besonders herauszuhebende Schwächen auf: So vertragen Mailinglists zum einen in nur einem ganz eng beschränkten Maße Paralleldiskussionen, zum zweiten lösen die in ihnen geführten Diskurse zu hoch auf, und zum dritten stellt sich die Frage, wie ein gutes Qualitätsniveau erreicht und gehalten werden kann. Diese Schwächen sollen zunächst ausführlicher veranschaulicht werden, um anschließend einige Überlegungen zu deren Behebung anzustellen.
Jeder neue Beitrag, gleichgültig ob er ein neues Thema initiiert oder ein bereits bestehendes Thema fortsetzt, konkurriert um die Aufmerksamkeit sämtlicher Mailinglist-Mitglieder.(Endnote 19) Mailinglist-Beiträge reproduzieren dabei zwar das Subsystem Wissenschaft, solange die Kommunikationen sich am Wahr/Unwahr-Code orientieren (vgl. Luhmann 1992). Und die Teilnahme an einer Mailinglist setzt, als nicht zu vernachlässigendes organisatorisches Moment, zudem eine Mitgliedschaft voraus, die durchaus an das Bewältigen höher Einstiegshürden und die Teilnahme an fortgesetzte Entscheidungen zur Aufrechterhalung der Mailinglist geknüpft sein kann. Doch die Selektion, Stabilisierung und Variation der aneinanderschliessenden Kommunikationen innerhalb der Mailinglist geschieht ganz überwiegend mit den vergleichsweise unterkomplexen Mitteln, wie sie von Interaktionssystemen zur Verfügung gestellt werden. Fernanwesende Teilnehmer korrigieren einander, fragen nach, bestreiten und bestärken, etwa so, wie sie es in einem Seminar oder auf einem Symposium auch täten. Im Unterschied zu Face-To-Face-Interaktionen geschieht dies jedoch raum- und zeitstellenflexibel sowie mit ungeprüfter Authentizität in einem obendrein auch noch maschinell zugänglichen Schriftmedium. Beiträge werden automatisch archiviert und können mit einfachen Mitteln anhand vorgegebener Begriffe technisch durchsucht werden. Es wird insofern nichts unkontrolliert, so wie in technisch nicht gestützten Interaktionssystemen, vergessen.(Endnote 20) Kurz gesagt: Die kommunikative Kapazität von Mailinglists entspricht derzeit, trotz einiger organisatorischer Eigenschaften, der fehlenden Authentizität von Argument und Person sowie der technischen Stützung, die keine face-to-face-Anwesenheit voraussetzt, weitgehend der von Interaktionssystemen.(Endnote 21)
Ferner ist bei den derzeitigen Mailinglistdiskussionen auch das Auflösungsniveau der Kommunikationen in dem Sinne zu hoch, als dass einzelne, kleinformatige Thesen und Begriffe nahezu beliebig variiert, selegiert, stabilisiert werden, nicht jedoch methodisch vom Textkorpus abgesicherte, längerkettige Kommunikationsverblockungen zu bereits stabilisierten Beobachtungen, Modellen und Theorien, auf die sich die Entscheidungen in Form von Bewertungen und Urteilen von Wissenschaftsinstitutionen als ganze beziehen könnten und die Neueinsteigern eine Orientierung in der Textlandschaft bieten. Grundlegende Paradoxien und altbekannte Einsprüche müssen immer wieder auf's Neue behandelt werden.
Und es fehlt bei den meisten offen zugänglichen, wissenschaftlichen Mailinglists an programmatischen Vorrichtungen, mit denen sich Beiträge in einen bereits bestehenden Diskurs strukturell einbinden, auf eine demokratietheoretisch akzeptable Weise bewerten und gegebenenfalls, zur Wahrung einer erwartbaren Qualität, auch von der Publikation ausschließen lassen. Bislang verständigen sich die Teilnehmer offen zugänglicher elektronischer Foren vorwiegend anhand programmatischer Beiträge über Erwartungen an Zweck und Qualität der von ihnen genutzten Foren. Das ist zwar ein diskursives, für alle Teilnehmer klar durchsichtiges und damit wissenschaftspolitisch begrüßenswertes Verfahren zur Regulierung der Themen und Qualität von Beiträgen, doch reicht die Zahl solcher Regulativbeiträge in manchen Malinglists sporadisch an die der thematisch orientierten Nutzbeiträge heran oder übertrifft diese sogar. In einigen Fällen behilft man sich zur Besserung des Rausch-Nutzsignalabstands stattdessen damit, Moderatoren einzusetzen, denen Diskursbeiträge vor der Weiterleitung an die Mailinglistmitglieder zugeschickt werden müssen und die diese dann, nach welchen Kriterien auch immer, entweder weiterleiten oder zurückschicken und ablehnen.(Endnote 22) Diese Verfahren sind entweder politisch nicht hinreichend durchsichtig und legitimiert oder aufwändig und anstrengend oder funktionieren zu langsam und können dadurch auf Dauer auf alle Beteiligten entmutigend wirken.
Statt die traditionellen Verfahren aus der Papier-Ära auf das elektronische Verbreitungsmedium zu übertragen, stellt sich die Frage, ob Bewertungsverfahren auf Grundlage eines elektronischen Verbreitungsmediums nicht ganz anders funktionieren sollten.
Es gilt, die operative Leichtigkeit der Publikation, Distribution und Konsumtion von Texten in elektronischen Diskursforen mit einer ebensolchen operativen Leichtigkeit auch bei der kommunikativen Bewertung von Texten zu verbinden. Oder etwas anders formuliert: Es gilt, die neue Leichtigkeit, mit der Mitglieder auf elektronischer Basis aktiv an Diskussionen teilnehmen können, nicht durch die traditionell-repräsentativen Bewertungsverfahren auszubremsen. Kommt in einer Mailinglist eine Diskussion, also eine Verkettung von Beiträgen, die im Netzjargon als Thread (engl.: Faden, auch: Gewinde) bezeichnet wird, zustande, dann war jeder Beitrag dazu, im Nachhinein betrachtet, einfach faktisch relevant. Ob ein Thread entstehen wird - der sich durchaus an einem offensichtlich inadäquaten Beitrag entzünden kann, an dem beispielsweise die mangelnde Qualität thematisiert wird -, ist grundsätzlich im Vorhinein auch durch fachlich überaus kompetente Experten nicht abzusehen. Trotz der Problematik vorwegnehmender Filterungen muss es auf der anderen Seite Mittel geben, die es Diskurs-Teilnehmern bei Bedarf ermöglichen, ihren technisch formulierbaren, persönlichen Bewertungsfilter so zu trimmen, dass möglichst nur die interessanten Beiträge passieren.
Eine netzadäquate Lösung könnte darin bestehen, Beiträge durch die Mitglieder erst im Nachhinein bewerten zu lassen, so dass die Mitglieder bei fortgesetzter Nutzung je für sich Kriterien gewinnen können, die ihnen bei Bedarf eine persönliche Auswahl auch im Vorhinein zu treffen erlauben, die zugleich jederzeit revidiert werden kann. Es sind derzeit zwei Projekte zu nennen, die eine solche Lösung technisch umzusetzen versuchen:
In dem ersten Projekt können Mitglieder an einer, parallel zur Mailinglist eingerichteten Börse Aktien von Teilnehmern an Mailinglists sowie von Themen kaufen. Sobald ein Mailinglistmitglied als Autor auftritt, wird er automatisch an dieser Börse notiert. Nach einiger Zeit ergeben sich dann zumindest für einige Autoren und Themen höher dotierte Kurse, deren gute Verwertbarkeit sich zugleich als Maßstab für Wertschätzung interpretieren liessen (Mindbroker). Ein solches Verfahren ist sehr leistungsfähig, weil es die Entschiedenheit eines punktuell bestimmten, eindeutigen "Preises" bietet, ohne diese Bestimmtheit länger als für den jeweils interessanten Moment, an dem die Beteiligten an einer Entscheidung interessiert sind, festzuschreiben. Somit kommt es zu Konjunkturen der Wertschätzung von Autoren und Themen. Bislang leidet dieses Modell, das sich sehr viel breiter als nur zur Selbstregulation von Mailinglistbeiträgen nutzen läßt, daran, dass kein "echtes" Geld eingesetzt werden darf.
In dem zweiten zu nennenden Projekt bewerten die Mitglieder einer Liste die Beiträge analog zu Schulnoten, die an einen Scoring-Server geschickt werden. Der Server speist die dadurch zustandekommenden Bewertungsreports regelmäßig in die Mailinglist ein. Auf diese Weise schälen sich im Laufe der Zeit allseits geschätzte Themen und Autoren heraus, auf die die Mitglieder bei Bedarf ihre persönlichen Filter in den Mailprogrammen einstellen können. Zugleich werden allseits geschätzte Autoren ermutigt, weitere Beiträge anzufertigen, die Autoren schlecht bewerteter Beiträge werden von der Publikation weiterer Beiträge entmutigt (vgl. Rost 1998).
Bemerkenswert an dem zunächst vergleichsweise weniger elegant erscheinenden zweiten Verfahren ist, dass es nach Content-Quality und Thread-Quality zu unterscheiden erlaubt. Die Content-Quality zielt auf den inhaltlichen Gehalt eines Beitrags und muss von den Mitgliedern der Mailinglist beurteilt werden. Die Thread-Quality zielt dagegen auf die Attraktion eines Beitrags für Folgebeiträge und ist weitgehend technisch formalisiert beobachtbar. Wenn auf einen Beitrag weitere, bezugnehmende Beiträge folgen, dann hat ein solcher Beitrag faktisch eine hohe Thread-Qualität entwickelt.
| thread-quality: low | thread-quality: high | |
| content-qual: low | Ein thematisch und | Ein thematisch |
| kommunikativ belang- | guter Beitrag | |
| loser Beitrag | ||
| content-qual: high | Ein kommunikativ | Ein thematisch |
| guter Beitrag | und kommunikativ | |
| sehr guter Beitrag |
Eine hohe Content-Quality muss nicht zwangsläufig mit einer hohen Thread-Quality einhergehen: Ein inhaltlich gehaltvoller Beitrag (gar eines reputierlichen Autoren) bedarf womöglich weder einer Ergänzung noch gibt er einen Anlaß, etwas zu bestreiten. Wurden bis zu diesem Beitrag auch Gegenthesen präsentiert und Details ergänzt, so wirkt sich ausgerechnet die hohe inhaltliche Qualität dieses abschliessenden Beitrags fast als eine kommunikative Katastrophe aus. Denn das Thema stoppt schlagartig und fällt als eine weitere Pumpe für Nachfolgebeiträge aus. Die Thread-Qualität eines solchen Beitrags ist demnach maximal niedrig. Thematisch besonders gehaltvolle, gute Beiträge sind somit grundsätzlich erst einmal ein Risiko für den Fortbestand einer Mailinglist. Die kommunikative Katastrophe des Systemkollabs betrifft tatsächlich jedoch primär die thematische Autopoesis der Liste, die sich beendet, nicht aber die Autopoesis der Beiträge der Mailinglist insgesamt, weil Erinnerungen an gehaltvolle Debatten vermutlich das Entstehen neuer Beiträge zu anderen Themen auf ähnlichem Niveau erleichtern. Und: Der schmalbandige Kanal mit der geringen kommunikativen Kapazität eines Interaktionssystems wird durch den Abschluß eines Themas wieder frei.
Im Unterschied dazu können einzelne Beiträge, die inhaltlich weitgehend belanglos sind, durchaus eine hohe Thread-Qualität erreichen, indem sie zu nachfolgenden Beiträgen führen, die Verfehlungen oder die Belanglosigkeit des Beitrags feststellen. Beiträge dieser Art helfen, die thematischen Erwartungen und Qualitätsansprüche einer Mailinglist selbstorganisiert zu justieren. Allerdings gefährden fortgesetzt belanglose Beiträge, die permanent die Mailinglist selbst thematisieren und dann nicht einmal mehr von anderen Teilnehmern kommentiert werden, nicht nur die thematische Autopoiesis, sondern auch die langfristige Autopoesis der Reproduktion von Beiträgen aus Beiträgen insgesamt, weil mehrfach gescheiterte, ambitionierte Initiativbeiträge jeden neuen Beginn entmutigen. Eine derart derangierte Mailinglist überfordert durch den Wechsel von anhaltendem Rauschen und anhaltender Stille die Aufmerksamkeit der Mitglieder und macht das Forum für kompetente und eigentlich schreibbereite Teilnehmer unattraktiv.
Ein in beiden Dimensionen optimaler Mailinglistbeitrag bietet demnach sowohl eine inhaltlich-thematisch hohe Qualität und provoziert darüberhinaus bezugnehmende Folgeartikel. Ein solch optimaler Mailinglistbeitrag zeichnet sich, in einem fast perfekten Unterschied, um also nicht zu sagen: im Gegensatz, zu traditionellen Aufsätzen in Fachzeitschriften oder Büchern, dadurch aus, dass er das Thema auch nicht andeutungsweise erschöpfend zu behandeln vorgibt, sondern sich knapp gehalten auf einen Aspekt konzentriert und dabei rhetorisch die Einnahme aussichtsreicher Gegenpositionen überläßt. Gegenargumente werden nicht schon vorwegnehmend-simulierend behandelt, sondern erst dann erörtert, nachdem sie tatsächlich vorgebracht wurden. Der aktive Umgang mit Mailinglists erzeugt dadurch ein methodisches bzw. strategisches Verständnis für den Einsatz verschiedener Textsorten.
Das Ziel beider Verfahren besteht darin, das Diskursniveau durch die Bewertung von Autoren und Themen mit neuen Mitteln zu regulieren.(Endnote 23) Diese neuen Verfahren sind für problemlösungs- und reflexionsorientierte Diskurse ungleich leistungsfähiger, weil diese der neuen Leichtigkeit der Mitteilungsverarbeitung, des Vertriebs und der Herstellung neuer Mitteilungen nun auch eine neue Leichtigkeit der transparenten Auswahl bzw. des Bewertens beiseitestellen. Zudem steigern sie die Rechtssicherheit der Funktionsträger von Diskursforen, wenn es darum gehen sollte, Autoren destruktiver Beiträge auszuschliessen.(Endnote 24)
Neben der Frage nach netzangemessenen Bewertungsverfahren von Diskursbeiträgen, die sich nicht länger an den für Papier tauglichen Verfahren orientieren müssen, stellt sich auch die Frage, welche neuen, netzangemessenen Strukturierungsmittel für Diskurse zur Verfügung stehen. Hier liesse sich an eine "Diskurs-Markup-Language" denken, mit der die Konditionierung der Kopplung von Sätzen an Sätze technisch-operativ ausgewiesen wäre (vgl. Rost 1996c). Mit Hilfe einer Diskurs-Markup-Language wäre es Autoren möglich, die Struktur von Diskursen bzw. die Verschränkung der Bezugnahme von Argumenten innerhalb eines Dokuments explizit auszuweisen. Und es wäre Lesern möglich, sich innerhalb eines Textkorpus effizient zu orientieren.
Zur Kennzeichnung der Struktur von Daten, die innerhalb wissenschaftlicher Diskurse typischerweise benutzt werden, bedarf es einer ganzen Reihe an Markups, etwa der folgenden Art: THESE, DEDUKTION, INDUKTION, ABDUKTION, ANMERKUNG, HINWEIS, ANEKDOTE, BEISPIEL, FRAGE, ANTWORT, ZUSAMMENFASSUNG, ZUSTIMMUNG, ABLEHNUNG, ZWEIFEL, BESTÄTIGUNG, PROGNOSE, BEOBACHTUNG. All diese Bezeichnungen kennzeichnen Aussagen von Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Solche Markups, die die Elemente einer Art Diskurs-Grammatik bezeichneten, ließen sich dann jeweils mit Attributen versehen, um zu differenzierteren Anschlüssen von Sätzen an Sätze zu gelangen. ANMERKUNGEN etwa wären beispielsweise in historische, soziologische, logische, psychologische, etymologische, physikalische oder natürlich auch in ökonomische und politische zu unterteilen. Zusammengehalten wird dieses Set an Markups unter dem Aspekt, ob sie die Oszillation zwischen wahrer und falscher Argumentation, wie sie für wissenschaftliche Kommunikation bezeichnend ist, gestatten.
Ein mit einer DML strukturiertes Dokument könnte beispielsweise wie folgt aussehen:
<!DOCTYPE SOCIOLOGY-DML.DTD "-//W3C//DML 5.0//DE"> <DML-SOCIOLOGY> <GETLINK:SOCIOLOGY> <PUTLINK:SOCIOLOGY>Computernetze, industrielle Revolution</PUTLINK> <BODY> <THESE1> Mit der Nutzung der Computernetze vollendet sich das Projekt der Industrialisierung. </THESE1> <ANMERKUNG1:THESE1> Die gewagte Verwendung des Begriffs <M>Vollendung</M> bezieht sich auf die der Physik entlehnten Differenz von Energie und Information: Nachdem sich die mit Energieumwandlungen befaßten gesellschaftlichen Bereiche bereits seit dem 19. Jahrundert in einem Prozeß der Industrialisierung befinden, werden nun auch die bislang aussenvorgelassenen gesellschaftlichen Bereiche der Informationsverarbeitung erfaßt. </ANMERKUNG> <THESE2> Eine <M>Industrialisierung</M> geht einher mit der Zunahme der <M>Demokratisierung</M>, <M>Kapitalisierung</M> und <M>Verwissenschaftlichung</M> einer <M>Gesellschaft</M> und bedeutet technisch eine maschinelle Herstellung von <M>Maschinen</M> durch Maschinen. <GETLINK:HISTORY,POLITOLOGY,ECONOMY,TECHNOLOGY> </THESE2> <DEDUKTION1:THESE1-THESE2><PUTLINK:SOCIOLOGY> Mit der Nutzung der Computernetze vollendet sich die Demokratisierung, Kapitalisierung und Verwissenschaftlichung einer Gesellschaft. </PUTLINK></DEDUKTION> </BODY> </DML-SOCIOLOGY>
Durch eine DML wäre zugleich eine hochauflösende Adressierbarkeit wissenschaftlicher Kommunikationen als auch deren industrielle Verarbeitung erreicht. Die zugrundeliegende Diskursgrammatik kann, weil sie symbolisch explizit ausgewiesen ist, selbst zum Gegenstand kommunikativer Reflexionen und technischer Operationen werden. Die Einführung einer DML zur Strukturierung von Diskursen bedeutete eine Abkehr von konventionellen Textverarbeitungen, die wie WinWord bloss der Vervollkommnung des Papierparadigmas verhaftet sind, und eine Hinwendung zu operativ orientierten Datenbank- und Workflowsystemen.(Endnote 25)
Eine DML liesse sich sinnvoll zur Strukturierung der Diskurse auch in Mailinglists einsetzen, um auf diese Weise zu einem höheren Aggregationsniveau von Argumenten und Thesenfolgen zu gelangen. Eine DML wäre aber vor allem sinnvoll, um den konventionell als Enzyklopädie organisierten Textkorpus einer Wissenschaft zu strukturieren. Ein solcher Textkorpus, der konkret über verteilte Datenbanksysteme organisiert wäre(Endnote 26) , sollte dann per Web zugänglich sein. Unter dieser Perspektive ist die geringe Kapazität einer Mailinglist in Bezug auf parallel führbare Debatten vielleicht nicht einmal eine Schwäche.(Endnote 27)
Endnoten
Endnote 1: Ich schliesse mit den nachfolgenden Ausführungen an erste Überlegungen dazu an (vgl. Rost 1998). - zurück -
Endnote 2: Es scheint bei den Autorinnen das Vorurteil vorzuliegen, dass dem schriftlichen Diskurs nicht die gleiche Flüchtigkeit in Bezug auf die Formulierung von Ergebnissen zugestanden werden sollte, wie dem mündlichen. Hier zeigen sich Reste einer Magisierung des geschriebenen Wortes. - zurück -
Endnote 3: Dies geschieht, um nur die Stichworte zu nennen, durch Workflow- und Geschäftsmodell-Systeme, Content-Management-Systeme, Document-Managing-Systeme, Wissensdatenbanken, Autoren- und Redaktionssysteme. - zurück -
Endnote 4: Obwohl ein solches Verständnis etymologisch naheliegen mag: "Maschine [frz., aus grch. mechane >Werkzeug<], jede Vorrichtung zur Erzeugung oder Übertragung von Kräften, die nutzbare Arbeit leistet (Arbeitsmaschine) oder die eine Energieform in eine andere verwandelt (Kraftmaschine) (...)" (DTV-Lexikon 1995: 11/ 294). - zurück -
Endnote 5: Im Zuge der kommunikationstheoretischen Wende der Soziologie wird der technische Ausgangspunkt der industriellen Revolution heute gern auf die Gutenbergsche Druckmaschine mit beweglichen Lettern vorverlegt (vgl. Goody et al. 1986/ Haarmann 1990). Sie erst machte "Papiermaschinen" in Form von gedruckt-verschriftlichter und -gezeichneter Kommunikation möglich. - zurück -
Endnote 6: So wie die Dampfmaschine die Voraussetzung für ihre eigene Entwicklung im Hinblick auf Steigerung ihres Wirkungsrades war, so sind das heutzutage Programmcompiler, die durch Selbstkompilation ihr Leistungsspektrum vergrößern. - zurück -
Endnote 7: Diese Differenz, nämlich zugleich als Medium und Maschine zu operieren, kennzeichnet speziell den Computer gegenüber den anderen Verbreitungsmedien (vgl. Esposito 1993). Halfmann universalisiert diese Unterscheidung dann noch einmal durch die Unterscheidung in Medium und Installation (vgl. Halfmann 1996). - zurück -
Endnote 8: Nach Fuchs (vgl. Fuchs 1997) markieren Adressen die Re-Entry-Stellen kognitiver Systeme. Damit fungiert eine Adresse gerade auch als ein Kontaktpunkt eines Systems zu sich selbst. - zurück -
Endnote 9: In der weniger adretten Variante ist auf E-Mail-Schnüffelsoftware hinzuweisen, wie sie Nachrichtendienste (Ruhmann/ Schulzki-Haddouti 1998) oder offenbar auch Betriebe einsetzen (erste Hinweise vgl. Schmitz 1996). - zurück -
Endnote 10: Aus dem Buch
"Soziologische Gesellschaftsbegriffe - Konzepte moderner
Zeitdiagnosen" (Kneer/ Nassehi/ Schroer 1997) seien die
Überschriften aufgezählt:
Rolf Eickelpasch: Postmoderne Gesellschaft (11), Frank-Olaf
Radtke: Multikulturelle Gesellschaft (32), Stefanie Ernst: Schamlose
Gesellschaft (51), Georg Kneer/ Gerd Nollmann: Funktional
differenzierte Gesellschaft (76), Frank Hillebrandt:
Disziplinargesellschaft (101), Stefanie Engler: Geschlecht in der
Gesellschaft - Jenseits des Patriarchats (127), Markus Schroer:
Individualisierte Gesellschaft (157), Dirk Richter: Weltgesellschaft
(184), Rolf Eickelpasch/ Claudia Rademacher: Postindustrielle
Gesellschaft (205), Georg Kneer: Zivilgesellschaft (228), Armin
Nassehi: Risikogesellschaft (252), Klaus Kraemer: Marktgesellschaft
(280), Harald Funke: Erlebnisgesellschaft (305), Manfred Faßler:
Informations- und Mediengesellschaft (332).
- zurück -
Endnote 11: Im Zuge der Vollendung des Projekts der Industrialisierung wäre es im übrigen plausibel anzunehmen, wenn als allgemeine Kompetenzen neben Rechnen, Lesen und Schreiben das Programmieren hinzuträte. Automaten liessen sich dann nicht nur autonom bedienen sondern herstellen. - zurück -
Endnote 12: Schließlich arbeiten die vielen derzeit wieder neu eingestellten Informatiker und Programmierer auch jenseits von CASE ("Computer Aided Software Engineering") fieberhaft an der Abschaffung ihrer Arbeitsplätze, indem sie die netzgestützt-automatisierte Erstellung von Software, etwa auf Grundlage von Java-Beans, ausbauen. - zurück -
Endnote 13: Hier zeigen sich die Probleme, die auftreten, wenn ein Begriff, der ausschließlich zur Kennzeichnung von Strukturen organisatorischer Systeme geeignet ist, generalisiert als Gesellschaftsbegriff verwendet wird. Wenn man außerdem feststellt, dass die theorieleitende Bezeichnung einer Gesellschaft nach nur einem Funktionssystem, hier als "kapitalistisch", unzureichend ist, dann war offenbar die Frage "Industriegesellschaft oder Spätkapitalismus?" (vgl. Adorno 1969) in jeder Hinsicht perfekt falsch gestellt. - zurück -
Endnote 14: Dabei gilt es, soziologisch zunächst von den Bedingungen der Kommunikation auf das Vorliegen von Organisation zu schliessen und sich nicht vordergründig von ummauerten Räumen mit Schreibtischen, Fertigungsstraßen und Organisationsstrukturen beeindrucken zu lassen, auch wenn diese sich wiederum auf die Formung bestimmter Kommunikationen auswirken. - zurück -
Endnote 15: Ich habe die vorindustriell-zunftartigen Sozialverhältnisse insbesondere der Hochschulen, mit unterschiedlichen Graden der Auflösung, einmal durchdekliniert in: Rost 1996a; Rost 1996f; Rost 1997c. - zurück -
Endnote 16: Dieses Konstrukt Scientific Community entspricht im Bereich des Wissenschaftssystems der Figur der invisible hand der Ökonomie und der öffentlichen Meinung der Politik (vgl. Luhmann 1999: 21), referenziert dabei aber zugleich, im Unterschied zu den beiden anderen Figuren, auffälligerweise nicht auf Gesellschaftssysteme, sondern auf "Gruppe". Auch dies liesse sich als ein weiteres Indiz für die relative Unterkomplexität der Wissenschaftsorganisationen werten. - zurück -
Endnote 17: Dies stellt im Wissenschaftssystem ein ungleich größeres Problem dar als in anderen Funktionssystemen, mit Ausnahme der Kunst, die gleichsam funktional spezialisiert immer genau auf das Andere zielt. Paradoxerweise muss sich ein Wissenschaftler darauf verlassen, dass beispielsweise eine paradigmatisch hochbedeutsame Konstante wie die Lichtgeschwindigkeit tatsächlich eine Konstante ist, und doch muss er jederzeit damit rechnen, dass sich das Gegenteil herausstellen könnte. So legt eine Meldung der Zeitschrift Nature vom 21. Juli 2000, die mit Berichten zu neuen Experimenten aufwartet, neue Deutungen der "Konstanten" nahe. - zurück -
Endnote 18: Derzeit haben die bestehenden
Wissenschaftsorganisationen, außer der trivialen
Präsentation von Web-Seiten, noch wenig Greifbares im Hinblick
auf den Einsatz neuer Kommunikationstechniken zu bieten. Einigen
Fachgesellschaften ist aber zumindest das Bemühen nicht
abzusprechen. Siehe dazu den Schlussbericht der IuK-Initiative "Entwicklung von Konzepten zur
Neugestaltung der elektronischen Information und Kommunikation in
Wissenschaft und Technik durch die 4 Fachgesellschaften DMV, DPG, GDCh
und GI", vorgelegt von Prof. Martin Grötschel. Diesen vier
Fachgesellschaften (Deutsche Mathematiker-Vereinigung, Deutsche
Physikalische Gesellschaft, Gesellschaft Deutscher Chemiker,
Gesellschaft für Informatik), die die IuK-Initiative 1995
starteten, sind inzwischen weitere Fachgesellschaften beigetreten:
Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaften (DGfE),
Deutsche Gesellschaft für Psychologie (DGPs), Deutsche
Gesellschaft für Soziologie (DGS), Informationstechnische
Gesellschaft (ITG) im Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE) und
Verband Deutscher Biologen (VDBiol).
- zurück -
Endnote 19: Bislang versucht man sich damit zu behelfen, Schlüsselwörter entweder in der Subject- bzw. Betreff-Zeile oder im Header der E-Mail unterzubringen, die eine Vorauswahl zu treffen gestatten, so dass ein konzentriertes Verfolgen bestimmter Themen im gleichen Kanal erleichtert wird. - zurück -
Endnote 20: Dieser Unterschied zur Symposium-Situation könnte jedoch von dem Moment an schwinden, von dem an die Mikrofone für Sprecher zwecks Dokumentation des Symposiums an Spracherkennungssysteme angeschlossen sind, wie sie seit 1996 für PCs angeboten werden (Ohlendieck 1997). Ein solches System würde Sprachbeiträge nicht nur vertexten, sondern könnte darüberhinaus zu jedem vom Sprecher soeben verwendeten Wort selbsttätig Informationen zusammenstellen, die sich zur Stützung von Argumenten abrufen liessen. - zurück -
Endnote 21: Wenn die Zahl an Paralleldiskursen zunimmt und sich bestimmte Themen stabilisieren, behilft man sich derzeit damit, eine neue, thematisch verengte Mailinglist zu gründen. Die ML-Luhmann ist auf diese Weise aus der ML-Soziologie hervorgegangen. - zurück -
Endnote 22: Mit dieser klassischen Form der vorwegnehmenden Bewertung durch Experten (Redaktionen, Gutachter, Lektorate) haben auch altehrwürdige wissenschaftliche Zeitschriften kein Problem: Sie nutzen das Internet als einen weiteren Vertriebsweg. Nach ein zwei Jahren des Bangens und Zögern Mitte der 90er Jahre entdeckten sie, dass ihre Funktion für die Wissenschaft nicht darin besteht, das knappe Gut "bedruckbares Papier" zu verwalten, sondern für ein erwartbares Beitragsniveau zu sorgen. Dafür reicht es zunächst, die traditionellen Auswahl- und Bewertungsverfahren auf das neue Medium zu übertragen. Allerdings müssen zunächst sowohl die Arbeitsgeschwindigkeit zur Produktion der Urteile drastisch erhöht als auch Ansprüche an maschinelle Recherchierbarkeit von Beiträgen befriedigt werden. Außerdem wird sich erweisen müssen, ob Fachzeitschriften mit dem Umstieg auf das elektronische Medium ihre teilweise unverschämt hohen Preise wie für die Printausgaben werden halten können (vgl. Bär 1999). - zurück -
Endnote 23: Nicht ganz so demokratisch fair wie die hier vorgestellten, aber in der Praxis offenbar tauglich, ist das Scoringverfahren, das bei Slashdot, einer weltweit einflussreichen Online-Publikation, benutzt wird. Hier können Autoren, die fortgesetzt gute Beiträge publizieren, in einer durch Punkte angezeigten Redaktionshierarchie aufsteigen und ihrerseits Beiträge anderer Autoren bewerten. - zurück -
Endnote 24: Hinzukommt ein weiterer Aspekt, der zumindest noch ganz knapp erwähnt werden sollte: Das oben knapp vorgestellte Modell einer Autoren- und Themenbörse könnte die ökonomisch bislang prekäre Situation für Autoren elektronischer Medien ändern. Technisch wäre es sinnvoll, wenn neben der Börsennotierung der Abruf einer Homepage, auf der sich ein Diskussionsbeitrag befindet, dazu führte, dass automatisch ein kleiner Betrag, in der Größenordnung vielleicht eines Bruchteils eines Pfennigs, von dem elektronisch zugänglichen Konto des Abrufers auf das ebenfalls elektronisch zugängliche Konto des Autoren automatisch überwiesen würde. Optimal wär es, wenn eine Abrechnungsfunktionalität bereits vom Netzprotokoll vorbereitet und unterstützt würde. Diskussionen zu diesem Thema werden seit langem unter dem Stichwort Micropayments und ip6ng geführt. - zurück -
Endnote 25: In Organisationen ist derzeit die Verwendung von Textverarbeitungen das größte Differenzierungshindernis, gerade weil deren Installation gemeinhin als gelungene, und damit abgeschlossene Differenzierung begriffen wird. - zurück -
Endnote 26: Vermutlich anhand auch von Überlegungen, die bereits im Zusammenhang mit der "Hyper-G"-Technik eine Rolle spielten (vgl. Dalitz/ Heyer 1995). - zurück -
Endnote 27: Eine interessante Verbindung der verschiedenen Netzdienste unter Nutzung ihrer jeweiligen Stärken bietet, unter einer einzigen Oberfläche integriert, DeleGate. - zurück -
4 Zum Kontext der untersuchten Mailinglists
Die Mailinglist für Soziologie (fortan abgekürzt zu "ML-Soziologie") wurde am 19. Januar 1995 zunächst auf meinem Privatrechner eingerichtet. Am 5. Mai 1995 wurde sie auf den Mailinglist-Server der GMD (damals "Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung", heute "Forschungszentrum Informationstechnik GmbH") in Sankt Augustin bei Bonn überführt, dessen Betrieb von der Deutschen Forschungsgemeinschaft im Rahmen des WIN genannten Wissenschaftsnetzes finanziert wird. Die Mailinglist für Luhmannsche Systemtheorie (fortan: "ML-Luhmann") wurde am 20. November 1995 von mir auf dem GMD-Server eingerichtet. Sowohl die Diskussionsbeiträge, die fortan als "Beiträge" oder auch "Artikel"(Endnote 1) bezeichnet werden, als auch die Teilnehmerlisten dieser beiden Mailinglists wurden von Beginn an archiviert.
Um für die in diesen beiden Listen festzustellenden Tendenzen einen weiteren Vergleich vornehmen zu können, wurde zu einigen Themen die Bestandsaufnahme auf die Mailinglist für Informationsgesellschaft, Medien und Demokratie (fortan: "ML-IMD") ausgeweitet. Allerdings ist die Datenlage dieser Liste sehr viel schlechter als die der anderen beiden Listen. Die ML-IMD wurde im September 1995 auf dem GMD-Server von Martin Recke und Rainer Rilling eingerichtet. Die Beiträge der ML-IMD werden seit Februar 1997 archiviert.
Diese drei Mailinglists sind allesamt offen zugänglich, mit allseitiger Publikationsberechtigung seitens der Mitglieder und unmoderiert eingerichtet. Sie sind somit keiner akademischen Öffentlichkeit vorbehalten, thematisch Interessierte können sich ohne Einschränkung in diese Mailinglists eintragen. Die ML-Luhmann entstand aus der ML-Soziologie heraus, nachdem sich zeigte, dass darin eine ganze Reihe an Systemtheorie-Spezialisten versammelt waren.(Endnote 2)
In der ersten Version einer Zweckbestimmung (als Teil einer "Charta") der ML-Soziologie vom 31. Mai 1995 heißt es:
Die Mailinglist fuer Soziologie soll zum einen als Forum fuer wissenschaftlich-soziologische Diskussionen ohne Themenvorgaben dienen. Zum anderen soll sie den Ausgangspunkt fuer weitere Planungen zur Nutzbarmachung der Computernetze fuer den soziologischen Diskurs bilden.
Am 7. Juli 1998 wurde diese Zweckbestimmung dann gestrafft:
Die Mailinglist fuer Soziologie soll als Forum fuer wissenschaftlich-soziologische Diskussionen dienen.
Die Zweckbestimmung der ML-Luhmann lautete zum Zeitpunkt der Einrichtung dieser Liste am 20. November 1995:
Die Luhmann-Mailinglist soll als Forum fuer einen kontingenten soziologischen Diskurs, mit spezieller Referenz zur Luhmann'schen Systemtheorie nach der autopoietischen Wende, dienen. Positive oder negative Bezugnahmen gelten dabei als gleichrangig.
Und ebenfalls am 7. Juli 1998 wurde auch dieser Text dann gestrafft:
Die Luhmann-Mailinglist soll als Forum fuer einen systemtheoretisch-soziologischen Diskurs dienen.
Diese Zweckbestimmungen sowie einige technische und organisatorische Hinweise werden jedem neu eingeschriebenen Teilnehmer automatisch zugeschickt.
Die ML-IMD ist weniger als die beiden anderen Listen auf wissenschaftlich-orientierte Teilnehmer hin ausgelegt, sondern hat auch eine politische Ausrichtung. Sie wurde zudem ohne eine wie oben festgeschriebene Zweckbestimmung eingerichtet. Stattdessen findet sich die folgenden Erklärung auf der Homepage der IMD:
... Die ML-IMD wurde im Sommer 1998 in eine Diskussionsliste (IMD-L) und in eine Ankündigungs- bzw. Informationsliste (IMD-Announce) aufgeteilt. Die IMD-Announce-Liste informiert über Veranstaltungen, Veröffentlichungen und Web-Seiten, soweit sie politische, insbesondere demokratiepolitische Fragen der Medien und Informationsgesellschaft betreffen. Sie ist also ausschliesslich eine Ankündigungs- und Informationsliste. Eine Mail an diese Liste sollte etwas mit einem Datum, einer Netz-Adresse oder einem Texttitel zu tun haben. Nachfragen dazu sind natürlich möglich, Diskussionen, Analysen, Stellungnahmen usw. jedoch sind der IMD-Diskussionsliste (IMD-L) vorbehalten, deren parallele Subskription wir empfehlen. Die IMD-L soll als Diskussionsliste fungieren.
Die ML-IMD hat eine ganze Reihe an Trägerorganisationen aus dem politisch klassisch-linken Spektrum an Organisationen (Gewerkschaften, Verbände) und Parteien (siehe die genaue Auflistung unter der oben angegeben WWW-Adresse). Diese Organisationen richteten zwei große Konferenzen aus, eine im Januar 1996 in Hamburg: "Informationsgesellschaft Medien Demokratie", eine weitere im Juli 1998 in Frankfurt "Machtfragen der Informationsgesellschaft".(Endnote 3)
Endnoten
Endnote 1: Dies als eingedeutschte Version von article, mit denen die Beiträge in den UseNet-Newsgroups bezeichnet werden. - zurück -
Endnote 2: Ich hatte im November 1995 mit einer raschen Zunahme weiterer sozialwissenschaftlich orientierter, offen zugänglicher Mailinglists speziell für den deutschsprachigen Raum gerechnet. Doch nichts dergleichen passierte. Abgesehen von einigen Dutzend internationalen Mailinglists zu soziologienahen Themen und philosophierenden Großautoren, die in den USA betrieben werden, sind speziell in Deutschland eine Dialektik-Mailinglist zu nennen, die als kleine, privat betriebene, eher philosophisch ausgerichtete Mailinglist ein durch Irrelevanz gefährdetes Dasein fristet, sowie die auf Online-Forschung spezialisierte GIR-L. - zurück -
Endnote 3: Die Ergebnisse der Konferenzen wurden in Buchform veröffentlicht: (siehe Bulmahn et al. 1996; Drossou et al. 1999). - zurück -
-->5 Methodische Aspekte der Untersuchung
- 5.1 Die Auswertung des Textarchivs
- 5.1.1 Die Ermittlung des Umfangs der Artikel
- 5.1.2 Die Auswertung der Beiträge
- 5.1.3 Die Auswertung der Themen
- 5.2 Die Auswertung der Mitgliederlisten
- 5.2.1 Die Ermittlung der Gesamtanzahl sämtlicher ML-Mitglieder
- 5.2.2 Die Ermittlung der Anzahl der Autoren
- 5.2.3 Die Ermittlung des Geschlechts
- 5.2.4 Die Ermittlung von Hochschul-Accounts
- 5.3 Der Fragebogen
- 5.3.1 Probleme technisch-operativer Art mit dem Fragebogen auf Seiten der Befragten
- 5.3.2 Probleme technisch-operativer Art seitens des automatischen Auszählens der Fragebögen
- 5.3.3 Methodische Unzulänglichkeiten des Fragebogens
- 5.3.4 Regeln der Auszählung
- 5.3.5 Die Rücklauf- und Beteiligungsquote
- 5.4 Überlegungen zu computergestützten Auswertungen und internetbasierten Umfragen
Die Untersuchung stützt sich auf drei Quellen: (a) Die archivierten Diskussionsbeiträge der Liste, (b) die Teilnehmerlisten der Mailinglists sowie (c) eine Befragung, die per E-Mail Anfang März 1999 durchgeführt wurde. Die Daten dieser drei Quellen wurden je für sich analysiert und nicht, was auswertungstechnisch naheläge, mittels einer Datenbank operativ zugänglich zusammengefügt. Insbesondere hätte es nahegelegen, die Daten der Fragebögen mit den Daten des Textarchivs zu koppeln, um etwa Eigenschaften der sich besonders aktiv beteiligenden Teilnehmer zu ermitteln. Eine solche Kopplung wäre aber nicht statthaft gewesen, weil sie über den Namen hätte erfolgen müssen und dann die Zusage der Anonymisierung der Fragebogendaten nicht hätte eingehalten werden können. Verknüpfungen dieser drei Quellen finden allein unter theoretischen Gesichtspunkten statt.
Nachfolgend werden zunächst die methodischen Aspekte der Untersuchung angesprochen. Zum Schluß dieses Abschnitts komme ich dann auf allgemeine Aspekte von computer- bzw. internetbasierten Datenerhebungen zu sprechen.
5.1 Die Auswertung des Textarchivs
Für die Auswertung der Beiträge wurden die Log-Dateien des Mailinglistservers der GMD (listserv@listserv.gmd.de) herangezogen. Der Server legt diese Archivdateien allmonatlich an, wenn im Kopf der Datei des Mitgliederverzeichnisses der Eintrag Notebook= Yes,B,Monthly steht. Die Log-Dateien sind für die Mitglieder der jeweiligen Mailinglist frei zugänglich.(Endnote 1) Die Beiträge der ML-Soziologie aus der Vor-GMD-Zeit wurden dem per WWW zugänglichen Archiv der Mailinglist entnommen, das zeitgleich mit der Mailinglist eingerichtet wurde.(Endnote 2) Für die Luhmann-Mailinglist ist darüberhinaus ein schönes, per Web zugängliches Archiv eingerichtet worden.
5.1.1 Die Ermittlung des Umfangs der Artikel
Der Umfang eines Artikels wird abzüglich des Umfangs des Headers angegeben. Die Signature-Zeilen, in denen am Ende eines Artikels die Adressen des Autoren sowie manchmal ein launiger Spruch angegeben sind, wurden dagegen nicht abgezogen, weil es keinen faktisch durchgesetzten Standard, sondern nur die Empfehlung "-" zur Kennzeichnung von Signatures gibt. Zum Umfang eines Artikels zählen ferner Textpassagen, die als Zitate ("Quotes") aus vorigen Artikeln gekennzeichnet sind sowie die Anhänge von Texten, die den selben Text noch einmal im HTML-Format enthalten. Den Anteil der Quotes- und HTML-Passagen wurde anhand von Defacto-Standards bestimmt, um einen möglichst realistischen Wert für den Realinput eines durchschnittlichen Beitrags zu erhalten. Als Defacto-Standard für Quotes gilt ein > zu Beginn einer Zeile, als Defacto-Standard für HTML-Anhänge ein <HTML>. Während HTML-Anhänge am Tag "<html>" verläßlich erkennbar sind, dürfte die tatsächliche Anzahl der Quotes höher liegen, weil sich nicht alle Mail-Programme an den Defacto-Standard halten und einige Autoren die Artikel, auf die sie Bezug nehmen, auch ganz ohne Quote-Kennzeichnungen vollständig im nicht standardisiert gekennzeichneten Anhang wiederholen. Schätzungsweise wurden rund 20% der Quotes nicht erkannt.
5.1.2 Die Auswertung der Beiträge
Die Themen, die durch Bezugnahmen der Artikel aufeinander entstanden und die nachfolgend als Threads bezeichnet werden, wurden anhand gleichlautender Subject-Zeilen ausgezählt. Die Defacto-Standards, die Anschlüsse von Beiträgen an vorausgegangene Beiträge signalisieren, sind solche Bestandteile in der Subject- bzw. Betreff-Zeile wie "Re:" und "(fwd)" sowie einige Permutationen davon, die nach Durchsicht der Artikel auffielen (wie etwa "(FWD)" oder "Re2:" oder "Re^2"), wurden vor dem Vergleich der Subject-Zeilen gelöscht. Verstümmelte Subject-Zeilen - die zumeist dadurch entstehen, wenn Mailprogramme Subject-Zeilen nach einer Zeilenlänge von 60 Zeichen schlicht abschneiden - werden als solche nicht erkannt, d.h. die auf diese Weise ausgezeichneten Beiträge bilden gegebenenfalls eigene Threads.
Von Threads ist für den Fall die Rede, in denen die Pause zwischen einem Artikel und einem Nachfolgeartikel, der das gleiche Subject trägt, 60 Tage nicht übersteigt. Dieser Wert wurde anhand der Überlegung gewählt, dass es Fälle geben könnte, in denen ein professionell Beteiligter sechs Wochen Urlaub hat und eine Woche jeweils Vor- und Nachlaufzeit beansprucht, bevor er einen bezugnehmenden Folgebeitrag verfaßt. Wird das gleiche Subject in größeren Abständen als zwei Monaten erneut aufgegriffen, machte es vermutlich mehr Sinn, allgemeiner von einem "Thema" oder einem "Super-Thread" zu sprechen.(Endnote 3)
Die Dauer von Threads wurde in Tagen bemessen, weil dies hinreichend genau ist. Eine Angabe in Stunden erschien bei dem derzeitigen Beitragsaufkommen als unanschaulich und unangemessen hochgetrieben präzise, schon weil die Taktung des Eingangs und Verteilens der Beiträge der Teilnehmer unterschiedlich ist.(Endnote 4)
Die recht hohe Standardabweichung bei der Länge und Dauer von Threads veranlaßte die Einführung einer Unterscheidung in zwei Thread-Faktoren, nämlich einen Faktor für überdurchschnittlich langkettige Threads und einen für überdurchschnittlich dauerhafte Threads. Um diese Faktoren zu ermitteln, wurde für jede Liste ein Thread-Mittelwert über den gesamten Untersuchungszeitraum ermittelt, und aus den Mittelwerten der drei Mailinglists wiederum ein gemeinsamer Mittelwert gebildet, das auf diese Weise gewonnene Ergebnis dann verdoppelt und gerundet. Damit ist festgelegt, dass Threads mit mindestens 10 Folgeartikeln als besonders lang, und Threads, die mindestens 14 Tage Tage andauern, als besonders dauerhaft zu bezeichnen sind. Eine tiefer gestaffelte Auswertung der Threads, wonach die Bezugnahme der Artikel untereinander innerhalb eines Threads noch im einzelnen berücksichtigt wird, war aufgrund der Datenlage nicht möglich. Ein technischer Mangel der Auszählung besteht darin, dass die Threads quartalsweise gruppiert und ausgezählt wurden, um möglichst wenige längerkettige, über einen Monatswechsel hinausreichende, Threads zu zerstören. Somit verbleiben pro Jahr immer noch vier Zeitpunkte, an denen unter Umständen Threads aufgrund des Auszählungsmodus auseinandergerissen wurden. Diese Vierteljahrestaktung des Threadauszählens wurde deshalb gewählt, um über den untersuchten Zeitraum der Konsolidierung der Listen hinweg eine Entwicklung im Hinblick auf Zu- oder Abnahme von Threads beobachten zu können.
5.1.3 Die Auswertung der Themen
Die Themen der Beiträge wurden anhand eines groben Schemas codifiziert und dann von einem Programm ausgezählt.(Endnote 5)
Wurden in einem Beitrag unterschiedliche Themen entsprechend des vorgelegten Schemas angesprochen, wurden selbstverständlich diese Themen auch unterschiedlich codiert. Insofern ist die Zahl der Beiträge einer Mailinglist und die Zahl der darin angesprochenen Themen nicht identisch.
5.2 Die Auswertung der Mitgliederlisten
Bei der Mitgliederliste einer Mailinglist handelt es sich um eine Datei im ASCII-Format, die sich auf dem Server der Mailinglist befindet. Hierbei enthält jede Zeile dieser Datei die E-Mailadresse sowie den Vor- und Nachnamen eines Mitgliedes. Diese Mitgliederliste kann von jedem Mitglied der Mailinglist bezogen werden.(Endnote 6) Die Bearbeitung der Adressliste, vornehmlich das Eintragen und Austragen von Teilnehmern, die diese Operationen mit ihrer Adresse aus welchen Gründen auch immer nicht mehr selbst durchführen können, bleibt allerdings dem Verwalter vorbehalten.
Als Verwalter der monatlichen Mitgliederlisten der ML-Soziologie und ML-Luhmann habe ich das Mitgliederverzeichnis nicht kontinuierlich jeden Monat angefordert, sondern immer dann, wenn bei mir zu viele Fehlermeldungen aufgrund nicht erreichbarer Mitglieder eintrafen. Für die hier vorliegende Auswertung wurden die Mitgliederverzeichnisse deshalb auf den 1. eines jeden Monats anhand der von mir archivierten Meldungen über die monatlichen Zu- und Abgänge der Liste standardisiert.
Während sich für die ML-Luhmann lückenlos für jeden Monat ein Mitgliederverzeichnis rekonstruieren ließ, war dies für die ML-Soziologie leider nicht möglich. Für die ML-Soziologie fehlen die Mitgliederlisten für 9706, 9707, 9708 sowie 9709, so dass für diesen Zeitraum keine Auszählungen durchgeführt werden konnten. Immerhin liessen sich aber dank einiger Teilnehmer, die diese Daten zufällig erhoben hatten und die ich in einem allgemeinen Aufruf über die Mailinglist um die Zusendung bat, die Teilnehmerzahlen ermitteln.(Endnote 7) Für die ML-IMD standen nur wenige, über den Zeitraum unregelmäßig verstreute Teilnehmerlisten zur Verfügung.
Die monatlichen Mitgliederlisten wurden vor dem Auszählen nicht auf Mehrfacheinträge im Hinblick auf Namensgleichheit durchgesehen und bereinigt. Ich gehe davon aus, dass die Zahl der Mehrfacheinträge in den Listen hinreichend konstant verteilt ist. Um die absolute Zahl der Mitlieder möglichst realitätsnah abschätzen zu können, wurde stichprobenweise im Hinblick auf Mehrfacheinträge ausgezählt. Diese Auszählung ergab, dass rund 13% der Mitglieder einer Liste, soweit dies anhand der Vor- und Nachnamen ersichtlich ist, mit mehr als nur einer einzigen E-Mailadresse vertreten sind. Es ist problematisch, Mehrfacheinträge genauer zu ermitteln oder diese zu nur einem einzigen Eintrag zusammenzuziehen, weil zu beobachten ist, dass eine bislang unabschätzbare Anzahl an Mitgliedern mehrere unterschiedliche Rollen von verschiedenen Adressen aus einnehmen. Diese Beobachtung ist auch von begrifflich-theoretischem Interesse, weil man eigentlich nicht länger von Autorinnen und Autoren sprechen kann, und dahinter kurzschlüssig Menschen vermutet, sondern genauer von Adressen, von denen aus Beiträge an einen Mailinglist-Server verschickt werden. Eine solche Adresse kann auf einen Menschen gemapt sein, der jedoch zugleich von einer anderen Adresse aus eine ganz andere textliche Inszenierung seiner Person bevorzugen mag. Und nicht minder bedeutsam ist der Umstand, dass auch Autorenkollektive problemlos und unerkannt von einer Adresse ebenso wie Text-Maschinen, so wie sie beispielsweise als "Robots" in Chat-Rooms gang und gäbe sind, operieren können.
Die Mitgliederliste wurde nicht länderspezifisch ausgewertet, weil eine ernstzunehmende Anzahl an Adressen länderspezifisch nicht auswertbar sind und dann überwiegend unter USA gebucht werden. Letzteres trifft auf Mitglieder zu, deren E-Mailadresse beispielsweise ein "cis.com", "compuserve.com", ".net", ".org" oder "aol.com" enthalten. Dies ist offensichtlich schlicht falsch, denkt man allein an die vielen CompuServe und insbesondere AOL-Nutzer allein in Deutschland. Dieser Fehler hätte verringert werden können durch einen auf Plausibilität hin angelegten Abgleich mit den Vor- und Nachnamen. Da ich zudem weiss, dass eine ganze Reihe an Deutschen im Ausland mit folglich nicht-deutschen Mailadressen an der Mailinglist teilnehmen, erschien mir das Aufwand-Nutzen-Verhältnis zur Untersuchung dieser Frage endgültig als fragwürdig. Eingedenk dessen werden diese Zahlen also nicht in den Auswertungsteil mit aufgenommen, sondern hier schlicht unbearbeitet, so wie sie der Listserver anlieferte, präsentiert.
* Country Subscribers * ------- ----------- * Argentina 1 * Australia 2 * Austria 28 * Brazil 1 * Canada 1 * Denmark 1 * France 1 * Germany 407 * Great Britain 2 * Greece 1 * Ireland 1 * Italy 1 * Japan 1 * Luxembourg 3 * Netherlands 4 * Norway 2 * Romania 1 * Spain 1 * Sweden 3 * Switzerland 8 * USA 50 * ??? 1 * Total number of "concealed" subscribers: 5 * Total number of users subscribed to the list: 521 (non-"concealed" only) * Total number of countries represented: 22 (non-"concealed" only) * Total number of local node users on the list: 0 (non-"concealed" only)
Verteilung der nach Ländern sortierten Mitglieder der ML-Soziologie
* Country Subscribers * ------- ----------- * ??? (2]) 1 * Austria 35 * Belgium 6 * Brazil 5 * Colombia 1 * Denmark 13 * Finland 2 * France 1 * Germany 231 * Great Britain 9 * Greece 1 * Italy 6 * Japan 5 * Luxembourg 1 * Mexico 1 * Netherlands 5 * Norway 5 * Romania 1 * Spain 3 * Sweden 2 * Switzerland 16 * Taiwan 1 * USA 54 * Total number of "concealed" subscribers: 32 * Total number of users subscribed to the list: 405 (non-"concealed" only) * Total number of countries represented: 23 (non-"concealed" only) * Total number of local node users on the list: 0 (non-"concealed" only)
Verteilung der nach Ländern sortierten Mitglieder der ML-Luhmann
5.2.1 Die Ermittlung der Gesamtanzahl sämtlicher ML-Mitglieder
Trotz der oben geäußerten Bedenken, eine materiale und kommunikative Identität der Mitglieder von Mailinglists für die Ermittlung der Gesamtzahl der Mitglieder und Autoren, die jemals in einer Mailinglist eingeschrieben waren bzw. mit einem Beitrag in Erscheinung traten, zu erzwingen, wurden die monatlich erstellten Mitgliederlisten zu einer einzigen Datei zusammengefügt und für diesen speziellen Fall einmal im Hinblick auf Mehrfacheinträge anhand der Vor- und Nachnamen bereinigt. Denn offensichtlich änderten sich im Laufe der Jahre die E-Mailadressen bei einer ganzen Reihe an Mitgliedern, ohne dass dafür begründete Absichten im Hinblick auf das Einnehmen verschiedener Rollen zu vermuten ist.(Endnote 8) Zur Bereinigung wurden die GNU-Textanalysetools sort, das Dateien zeilenweise sortiert, und uniq, das gleichlautende Zeilen von Dateien löscht, genutzt. In der abschliessenden Kontrolle wurden dann noch einmal ziemlich genau 10% an nicht trivial-technisch erkennbaren Doppeleinträgen herausgefischt.
Leider war es nicht möglich, mit vertretbarem Aufwand kontinuierlich die monatlichen Zu- und Abgänge der Listen festzustellen, um einen Wert für die monatlichen Fluktuationen der Liste zu ermitteln. Hier einen realistischen Wert anzugeben, wäre allerdings ohnehin problematisch gewesen, weil viele Mitglieder sich nicht aus der Liste austragen, bevor sie ihren Account verlieren, ihn aufgeben oder wechseln. Solche Mitglieder habe ich in unregelmäßigen Abständen von Hand ausgetragen. Für eine Abschätzung der monatlichen Erreichbarkeit der Mitglieder wäre ferner in Rechnung zu stellen, dass technische Unzulänglichkeiten (wie etwa zeitweise ausgefallene Server) es oftmals nicht entscheidbar machen, ob eine E-Mail-Adresse aktuell nun gültig ist oder nicht.
5.2.2 Die Ermittlung der Anzahl der Autoren
Die Liste mit den über den gesamten untersuchten Zeitraum am häufigsten in Erscheinung getretenen Teilnehmern, die aktiv schreibend an der Mailinglist teilnehmen (Autoren), wurden zunächst automatisiert erstellt, indem die From:-Zeilen aus den archivierten Beiträgen herausgesucht wurden. In der Nachbearbeitung wurden anschliessend, so weit aus den Permutationen von Namensbestandteilen ersichtlich, nur solche Autorennamen aggregiert, die unter einem einzigen Autorennamen mindestens 10 Mal in Erscheinung traten. Diese Aggregation war notwendig, weil oftmals bei einem Accountwechsel die Anordnung der Vor- und Nachnamen getauscht und mal ein akademischer Titel angegeben wurde und mal nicht.(Endnote 9) Unter Umständen entgingen auf diese Weise einige Autoren, die unter häufig wechselnden Namen jeweils nur wenige Beiträge publizierten und die deshalb vielleicht unangemessener Weise nur im unteren Mittelfeld positioniert sind - doch es lag nicht in der Absicht dieser Studie, eine in jeder Position gültige Hitliste von Autoren zu erstellen, sondern vielmehr zu ermitteln, welche Autoren den Diskurs am meisten beeinflussten. Und diese Zahlen sind eindeutig.
5.2.3 Die Ermittlung des Geschlechts
Das Geschlecht der Autorinnen und Autoren wurde wie das der Mitglieder anhand der Vornamen ermittelt. In einige Fällen war das Geschlecht nicht zu bestimmen, entweder weil kein Vornamen angegeben wurde, der Vorname unbekannt war oder der Name einer Institution angegeben wurde. Wenn im letzteren Fall ein Autor klar ersichtlich unter dem Namen dieser Institution schrieb, dessen Geschlecht anhand des Namens ermittelt werden konnte, so wurde dem Artikel dieser Institution das Geschlecht des Autoren zugeordnet. Den Fehler durch geschlechtsindifferente Namen (wie etwa Maria oder Helge, die allerdings nicht vorkamen) ist aufs Ganze gesehen vernachlässigbar.
5.2.4 Die Ermittlung von Hochschul-Accounts
Die Uni-Accounts wurden nach Durchsicht der Mitgliederverzeichnisse anhand einer Liste mit Hochschul-typischen E-Mail-Adress-Bestandteilen ermittelt (.fernuni-, .fh-, .fu-, .hu-, .th-, .tu-, .tuwien, .uni-, .univie, .unibw-, .wu-, .wz-, @informatik, @euv-, @ku-).
5.3 Der Fragebogen
Der Internet-Befragungsliteratur war zu entnehmen, dass bei unverlangt zugeschickten E-Mail-Fragebögen, die den Empfänger im Modus einer unpersönlich zugestellten Postwurfsendung erreichen, mit einer Rücklaufquote von ca. 5% gerechnet werden darf (Batinic 1997). Ich verwendete deshalb viel Mühe darauf, eine bessere Quote zu erreichen.
Obwohl es ungleich komfortabler und kostengünstiger gewesen wäre, den Fragebogen zentral über die Mailinglists zu schicken, wurde er an jedes Mitglied der ML-Soziologie und ML-Luhmann einzeln adressiert. Als Rücksendeadresse, an der die beantworteten Fragebögen eingesammelt wurden, war eine spezielle Reply-Adresse vorgegeben, um Fehladressierungen beim Zurückschicken beantworteter Fragebögen, etwa an die Mailinglist, schon aus datenschutzrechtlichen Gründen so unwahrscheinlich wie möglich zu machen. Außerdem lag mir daran, jeden Befragten persönlich ansprechen zu können und dem Risiko aus dem Wege zu gehen, dass Diskussionen über den Fragebogen auf der Mailinglist die bis dahin noch nicht Geantwortethabenden beeinflussen. Zusätzlich zu den beiden extra eingerichteten Befragungs-Accounts ("umfrage_soziologie@maroki.netzservice.de" und "umfrage_luhmann@maroki.netzservice.de"), von denen die Fragebögen verschickt und eingesammelt wurden, war eine weitere E-Mail-Adresse eingerichtet, über die Rückfragen zum Fragebogen möglch waren ("umfrage_support"). Der Support-Account wurde dann auch in recht großem Umfang genutzt.
Für einen Pretest des Fragebogens wurden je 20 Adressen aus beiden Mailinglists zufällig gezogen. Die Rücklaufquote des Pretests betrug innerhalb der gesetzten Befragungsfrist 32.5%, eingerechnet der Nachzügler 37.5%. Die Auswertung des Pretests führte vor allem zu Änderungen bei Fragen, die offensichtlich zu Mehrfachantworten einluden. Es wurden weitere Antwortvorgaben und auch weitere Fragen hinzugenommen und die meisten der offen gestellten Fragen geschlossen, um die automatische Auswertung zu vereinfachen.
Der überarbeitete Fragebogen wurde dann am Donnerstag, den 04.03. 1999, zwischen 00.30 und 03.05 Uhr morgens per E-Mail sämtlichen Mitgliedern der beiden Mailinglist zugeschickt, so dass er den Befragten am Donnerstag Morgen vorlag. Dieser Termin wurde gewählt aufgrund der Überlegung, dass an einem Donnerstag die Arbeit der Woche bereits überschaut werden kann und die Konzeption für das Wochenende oftmals noch nicht festgelegt ist. In diese Lücke hinein sollte die erste Begegnung mit dem Fragebogen plaziert sein. Den Nachteil, dass zu diesem Zeitpunkt vielen Orts Semesterferien waren, musste wegen interner Terminprobleme inkaufgenommen werden. Der Ablauf des Befragungszeitraums war mit dem 12.03.1999, 18 Uhr (Eingangsstempel des korrekt auf Ortszeit eingestellten, einsammelnden PCs) festgesetzt.
Nach Ablauf der Hälfte des Befragungszeitraums wurden all denjenigen Mitgliedern der Liste, die bis dahin den Fragebogen noch nicht beantwortet hatten, eine Erinnerungsmail geschickt. Diese Erinnerungsmail führte dazu, dass die Anzahl der eintreffenden Fragebögen zunahm. Einige der erneut angeschriebenen Mitglieder fühlten sich offenbar regelrecht unter Rechtfertigungsdruck gesetzt und teilten dies auch unmissverständlich mit (Anhang).
Der Fragebogen war so strukturiert, dass er von einem eigens dafür erstellten Programm(Endnote 10) automatisch ausgezählt werden konnte. Dieses Auszählprogramm war zwar robust ausgelegt, erwartungsgemäß traten trotzdem bei Testdurchgängen Antwortvariationen auf, die eine Bearbeitung der Originaldaten per Hand nötig machten, bevor dann anschließend das Auszählprogramm den Fragebogen codierte.
5.3.1 Probleme technisch-operativer Art mit dem Fragebogen auf Seiten der Befragten
Eine ganze Reihe von Teilnehmern berichtete, dass sie sich nicht in der Lage sähen, ein x zwischen den im Fragebogen vorgegebenen eckigen Klammern einzufügen. Dieses Phänomen war zunächst nicht zu erklären. Den ersten Teilnehmern, die von diesen Schwierigkeiten berichteten, wurde ein Fragebogen ohne eckige Klammern zugeschickt. Da es aber zu unwahrscheinlich erschien, dass es Mailprogramme gibt, die die eckigen Klammern als Steuerzeichen interpretierten und dadurch das Problem verursachten, schickte ich auf weitere Nachfragen eine Mail mit dem Hinweis zu, den Fragebogen abzuspeichern, in einen Editor zu laden, dort zu beantworten und diese Datei dann als Attachement zuzuschicken. Später stellte sich heraus, dass den Teilnehmern mit diesen Schwierigkeiten nicht klar war, dass sie die Fragebogen-Mail mit dem Beantworten-Befehl (Reply) vom Lesemodus in den Schreibmodus bringen mussten. Diese elementaren Fertigkeiten im Umgang mit einem Mailprogramm dürfen offenbar nicht als geläufig vorausgesetzt werden. Dieser Sachverhalt läßt sich als Indiz für das mangelnde Training bzw. generell für die schlechte Ausbildung an den Kommunikationsmaschinen werten. Insofern sollte man in dem Einleitungstext eines per E-Mail verschickten Fragebogens einen Hinweis darauf geben, dass man zur Beantwortung des Fragebogens vom Lese- in den Schreibmodus wechseln muss.
Ein weiteres technisches Problem stellte sich aufgrund der Länge der Fragebogen-Mail ein. Einige Editoren der Mailprogramme sind offenbar nicht in der Lage, E-Mails im Umfang von mehr als 27kB korrekt zu laden. Aus diesem Grunde sind einige der Fragebögen zum Ende hin (ab Frage V63) regelrecht abgerissen. Davon betroffen waren insbesondere Teilnehmer, die von T-Online-Accounts schrieben. Insofern sollte man darauf achten, dass ein Fragebogen die Länge von 25kB möglichst nicht überschreitet.
5.3.2 Probleme technisch-operativer Art seitens des automatischen Auszählens der Fragebögen
Das Programm zum Auszählen der per E-Mail eingetroffenen Fragebögen war daraufhin ausgelegt, dass die Antworten im ASCII-Klartext vorliegen. In insgesamt acht Fällen wurden base64-codierte, komprimierte Attachements, die in zwei Fällen obendrein die Antworten im WinWord-Format enthielten, zugeschickt. Diese Mails mussten zunächst von Hand ins ASCII-Format gewandelt werden. Insofern sollte man - solange ein Auszählprogramm nicht in der Lage ist, derartige Dateien automatisch zu dekodieren - im Einleitungstext nachdrücklich darum bitten, dass der beantwortete E-Mail-Fragebogen im ASCII-Klartext zurückgeschickt wird.
Generell hätte mit mehr Nachdruck auf den Umstand der automatischen Auswertung hingewiesen werden sollen. Es wäre zwecks Verringerung von Syntax-Fehlern seitens der Antwortenden sicher sinnvoll gewesen, wenn die vor die Klammer gezogenen Instruktionen im Kopf des Fragebogens durchnummeriert und klar vom sonstigen Text abgesetzt worden wären. Die Befragten hätten durch diesen optischen Halt leichter memorieren können, dass es bei den Antworten insgesamt drei herausgehobene Aspekte gab, die zu beachten waren.
Nicht standardisierte Bemerkungen, etwa wenn das Item "SONSTIGES" angekreuzt wurde, sollten außerhalb der Klammern notiert werden. Daran hat sich jedoch bis auf eine Ausnahme niemand gehalten. Solche Bemerkungen wurden ganz überwiegend zwischen den Klammern gefügt. Dies ist ein konsistentes Verhalten seitens der Befragten, erzeugte aber Probleme bei der automatischen Auszählung. Eine konsistente Benutzerführung ist wichtiger als die Berücksichtigung technischer Belange. Das Programm hätte entsprechend anders ausgelegt sein müssen.
In einigen Fällen, in denen um die Angabe einer Zahl gebeten wurde, waren die Zahlenbereiche oder Zahlen mit Textergänzung angegeben (beispielsweise in der Form 10 - 15 oder ca. 10). Das Zählprogramm erwartete an dieser Stelle jedoch nur eine einzige, ganze Zahl. In solchen Fällen wurde bei der Auswertung von Hand das arithmetische Mittel eingesetzt und gegebenenfalls nach oben hin aufgerundet. Insofern sollte man im Einleitungstext auf das Zahlenformat hinweisen und/ oder das Auszählprogramm robuster auslegen.
Es gab noch eine ganze Reihe an weiteren, fehlerhaft ausgefüllten Antworten, die vom Auszählprogramm nicht automatisiert ausgewertet werden konnten:
[ x ] [x [x[ [x = ] x[] []x [FONT face=Arial size=3>x</FONT>] [ [Nachname Vorname] x] [x] Es folgt Text, der statt des x zwischen den Klammern eingefügt sein sollte.
Darüberhinaus gab es einen Fall, bei dem sämtliche eigentlich vertikal angeordnete Antwort-Items durch Löschen des Zeilenende-Steuerzeichens zu einer einzigen Zeile zusammengefügt waren. Auch das erschwerte eine automatische Auszählung.
Anhand dieser empirisch ermittelten Fehler, die die konzeptionelle Phantasie während der Programmierung zum Teil überstiegen, lassen sich natürlich zukünftig Strategien zur Steigerung der Robustheit des Auszählprogramms entwickeln.
Bei den offen gestellten Fragen V43, V44, in denen Beurteilungen der Mailinglist abgegeben werden konnten, wurden in einem ersten Schritt die erhaltenen Antworten interpretiert und daraus eine Reihe von Kategorien für beide Listen entwickelt. Zur Steigerung der Ordnung der Darstellung sind die Kategorien nach Bereichen gegliedert, die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Gesamtrahmen der Listen stehen. Für beide Listen lassen sich eine Reihe von Bereichen unterscheiden, denen die kategorisierten Antworten dann zugeordnet wurden. Ein Teil der Kategorien wurde dem Bereich des konstitutiven Grundverständnisses der Liste zugeordnet, dem die Liste ihre Namensgebung verdankt. Ein weiterer Teil der Kategorien wurde dem technisch-organisatorischen Bereich zugeschlagen. Drittens liessen sich verschiedene Kategorien dem formalen Bereich der Diskussionsführung innerhalb der Liste zuzählen. Viertens wurde eine Reihe von Kategorien dem Bereich unterschiedlicher Bedeutungsgehalte von Beiträgen zugeschrieben. Und fünftens schließlich werden Kategorien unterschieden, die dem Bereich bezeichneter Erträge zugerechnet werden. Gemäß dieses Ordnungsrahmens wurden die Antworten einsortiert und dann ausgezählt.
Zum Teil waren die Antworten so beschaffen, dass sie mehrere Aspekte ansprachen. In solchen Fällen wurden die Antworten zerlegt und nach den darin enthaltenen Komponenten unterschieden.
5.3.3 Methodische Unzulänglichkeiten des Fragebogens
Es ist verständlich, dass sich Menschen wehren, wenn sie den Eindruck haben, die Auffangkomplexität eines Fragebogens werde ihnen nicht gerecht. Ein Fragebogen kann eine solche Erwartung des Gerechtwerdens bei nicht-trivialen Fragestellungen grundsätzlich nicht erfüllen, da er primär in eine spezifische Begriffs- und Forschungskonstellation eingespannt ist und von daher etwas anderes als ein Kompromiss zwischen gerade noch angemessener Auffangkomplexität und möglichst effektiver Auswertung nicht erwartet werden darf. Um den immer gegebenen Abwehrimpuls seitens der Befragten so gering wie möglich zu halten, waren eigens zwei offene Fragen vorgesehen, in denen die Befragten sich ohne standardisierte Vorgaben sowohl zur Mailinglist (Frage V43/ V44) als auch zum Fragebogen und der Forschungsfrage (V63) äußern konnten.
Das Hauptproblem bei der Auswertung der Fragebögen verursachten Mehrfachnennungen, die nicht vorgesehen waren. Auch wenn im Vorspann des Fragebogens geschrieben war, dass Mehrfachnennung zu vermeiden seien, so sind trotzdem häufig auftretende Mehrfachnennungen natürlich nicht nur als fehlende Disziplin seitens der Befragten, sondern ebenso als eine Schwäche der Frage- bzw. Antwortkonstruktionen zu werten.
Es wäre sinnvoll gewesen, trotz der hohen Redundanz, jedes Mal von Neuem hinzuschreiben, dass Mehrfachnennungen zu vermeiden sind. Die Auswahl anleitenden Bewertungsbegriffe wie "vorwiegend", "hauptsächlich" oder "primär" wirkten als Schutz gegen Mehrfachnennungen ganz offenbar zu schwach.(Endnote 11) Bei den Fragen V16, V17, V18, V52, V56 und V57 in den Fällen, in denen es zu Mehrfachnennungen kam, wurde die Anzahl der Mehrfachnennungen festgehalten: 2-fache Mehrfachnennung sowie Mehrfachnennungen > 2. Hier zeigt sich einfach das Problem, dass im ASCII-Code keine Möglichkeit besteht, mittels Layout einerseits die Gültigkeit einer Anweisung zu signalisieren und sie zugleich optisch zurückzunehmen.
Die am häufigsten anzutreffenden Mehrfachnennung waren:
V16 - "Drucke aus" und "Speicher im
Archivverzeichnis ab".
V17 - "bestimmte Autoren" und "interessante
Subjects".
V56 - "Ausprobieren am Buero/ Rechnerpool-PC" und
"Ausprobieren am Privat-PC", jeweils mit oder ohne Buch.
In V31 wurde der Begriff "Artikel" von einem Befragten mißverstanden im dem Sinne, ob man einen Artikel/ Aufsatz, der als Fachaufsatz in einem klassischen Papiermedium veröffentlicht wurde, nun zusätzlich auch in der Mailinglist publiziert hätte. Die Wahrscheinlichkeit für ein solches Mißverständnis wäre vermutlich kleiner gewesen, wenn statt von einem Artikel von einem Beitrag, wie zuvor schon, die Rede gewesen wäre.
In V32, der Frage danach, wieviele E-Mails zusätzlich zu einem Beitrag bidirektional verschickt werden, haben zwei Befragte "100" Mails angegeben. Eine solche Angabe weist auf eine nicht intendierte Interpretation hin. Gleiches gilt für V33. In einigen Fällen scheint es so, als ob die Frage so verstanden wurde, wie viele Mails insgesamt schon verschickt wurden. So wurde mehrere Male eine 100 eingegeben, in einem Falle 45. Danach war aber nicht gefragt. Derart unplausible Zahlenangaben, deren Missinterpretation als Fehler im Fragebogendesign zuzuschreiben ist, wurden als Fehler codiert.
In V58 und V59, den Fragen nach dem akademischen Status mit spezifischem/unspezifischem Bezug zur Soziologie, hätte beim Studium nach Neben- und Hauptfach unterschieden werden sollen. In einer ganzen Reihe von Fragebögen wurde sowohl bei V58 als auch bei V59 Studium angekreuzt, was bei Nebenfächlern auch Sinn macht. Ich habe diese aber nicht als Nebenfächler codiert, das erschien mir als zu unsicher, sondern als "mit spezifischem Bezug zur Soziologie" stehend vereindeutigt. Das primäre Interesse lag darin, den akademischen Status soziologischer Experten, zu denen auch die Nebenfächler zählen, von soziologisch Interessierten ohne jeglichen akademischen Bezug zu unterscheiden. Es sind trotzdem einige Fälle verblieben, die sich nicht vereindeutigen liessen, so dass Nennungen in beiden Fällen bestehen blieben.
In V61, der Frage nach dem Geschlecht, wurde eine falsche Anweisung gegeben. Es sollte ein x zwischen den Klammern eingefügt werden. Die Frage bat sinnloser Weise um die Angabe der Anzahl an Jahren.
An der Fragebogenkonstruktion wurde mehrfach moniert, dass keine Indifferenz- bzw. Neutral-Items wie "weiß ich nicht" oder "teils-teils" vorgesehen waren. Statt eine solche Kategorie vorzusehen, die zu stark der zentralen Tendenz unterliegen, legte ich mehr Wert auf Differenzierungen auf einer entschiedenen Seite. Methodisch ist das sicherlich diskussionswürdig.
5.3.4 Regeln der Auszählung
Wenn ein Fragebogen sowohl im ASCII-Klartext als auch zusätzlich per Attachement, typischerweise als HTML-Anlage, zugeschickt wurde, so wurde allein der voranstehende ASCII-Klartext ausgezählt.
Ausgezählt wurden nur solche Fragebögen, bei denen zumindest die Hälfte der Fragen beantwortet waren.
Wenn jemand umfangreichere Kommentare in einer Extra-Mail dem Fragebogen hinterherschickte, wurden diese Kommentare von Hand in die V63 kopiert. Diese Frage V63 war eigens für solche Kommentare vorgesehen.
Als in V64 formal nicht korrekt beantwortet eingestuft wurde ein Fragebogen dann, wenn Mehrfachnennungen auftraten; wenn es einen Verstoß gegen die Strukturvorgaben gab (beispielsweise ein x nicht zwischen den beiden eckigen Klammern eingefügt war) oder wenn der Fragebogen zum Ende hin abgerissen war, weil die Kapazität des Editors, in dem der Fragebogen bearbeitet wurde, nicht hinreichte.
5.3.5 Die Rücklauf- und Beteiligungsquote
| ML-Soz. | ML-Luh. | |
| Absolute Anzahl der insgesamt beantworteten Fragebögen: | 173 | 143 |
| Anteil der FB, die nach Fristablauf am 12.03., 18 Uhr eintrafen: | 11.6% | 15.4% |
| Absolute Anzahl der insgesamt angeschriebenen Teilnehmer: | 514 | 411 |
| Rücklaufquote unter Berücksichtigung der Teilnehmer-Gesamtzahl: | 33.7% | 34.8% |
| Rücklaufquote (berücks. die Teilnehm.-Gesamtzahl und Fehladr.): | 35.8% | 36.7% |
Es ließ sich nicht jeder Fragebogen zustellen, weil sich einige Adressen von Mailinglist-Mitgliedern als fehlerhaft herausstellten. Insofern macht es Sinn, eine um die Fehladressierungen bereinigte Rücklaufquote anzugeben.
Darüberhinaus ist es sinnvoll, neben der Rücklaufquote eine Beteiligungsquote auszuweisen, weil es eine ganze Reihe an Mails gab, die an die Support-Adresse adressiert waren und in denen Teilnehmer begründeten, warum sie den Fragebogen nicht ausfüllen wollten oder konnten. Wenn man auch diese Teilnehmer berücksichtigt, läßt sich der Umfang derjenigen, die in keinster Weise schreibend in Erscheinung treten wollen (oder können) und die im Netzjargon als Lurker bezeichnet werden, noch etwas besser eingrenzen.
| ML-Soz. | ML-Luh. | |
| Anzahl der fehlerhaft eingetroffenen Fragebögen: | ||
| - Mails waren nicht decodierbar: | 1 | 1 |
| - Mails waren nach wenigen Fragen abgerissen: | 1 | 0 |
| - Mails mit nicht-ausgefülltem FB: | 2 | 3 |
| Anzahl Mails an Support-Adr. von denen, die FB nicht beantworteten: | ||
| - Technische Begründung, warum der FB nicht ausgefüllt werden konnte: | 4 | 3 |
| - Inhaltlich Begründung, warum der FB nicht ausgefüllt wurde: | 32 | 15 |
| - Sprachlich Begründung, warum der FB nicht ausgefüllt wurde: | 2 | 1 |
| - Mails ohne Text: | 9 | 4 |
| - Anfrage, ob das Beantworten des FB noch Sinn mache (wurde verneint): | 6 | 5 |
| - Beantwortung des FB wurde in Aussicht gestellt, aber nicht eingelöst: | 10 | 5 |
| - Beantwortete FB, die nach Redaktionsschluß eintrafen: | 1 | 1 |
| Beteiligungsquote: (Teiln.Gesamtzahl - Fehlermeld. + fehlerh. FB + Suppanfr) | 49.9% | 46.4% |
Um die Zahl der Hardcore-Lurker, die definitiv niemals auf der Liste oder bei einer Befragung in Erscheinung treten (also knapp 50% sämtlicher Teilnehmer beider Listen), etwas einzugrenzen, lassen sich einige Faktoren nennen, die der Teilnahme am Mailinglistgeschehen oder einer Umfrage entgegenstehen:
Erreichbarkeit: Zum einen waren Semesterferien, wodurch insbesondere Studenten, die über keinen Privataccount in der Liste eingeschrieben sind, relativ unterrepräsentiert sein dürften. Technische Kompetenz: Es sind technische Probleme beim Beantworten von Mails in Rechnung zu stellen, seien diese dinghafter Art (Provider hat Probleme, der PC funktioniert nicht) oder kognitiver Art (generelles Ungelenksein im Umgang mit der Technik). Diesen technisch bedingten Anteil schätze ich relativ hoch ein. Zwar wurde die Hürde des Anmeldens in der Liste gemeistert, doch kann diese durch einen hilfreichen Experten vorgenommen worden sein. Es mögen Unsicherheiten darüber bestanden haben, ob bei einem etwaigen Reply der Fragebogen in die Mailinglist gerät und ähnliches mehr. Sprachliche Kompetenz: Bei nicht-deutschen Teilnehmern ist mit sprachlichen Problemen beim Verstehen und Beantworten von Mails zu rechnen. Doppelmitgliedschaft: Eine Doppelmitgliedschaft in beiden Listen kann dazu führen, dass der Fragebogen nur in einer der beiden Listen beantwortet wurde.
5.4 Überlegungen zu computergestützten Auswertungen und internetbasierten Umfragen
Einen aktuellen Diskussionsstand zum Einsatz von Computern zur Datenerhebung findet man bei Galliker (Galliker 1998). Wir müssen auf diese Diskussion, die sich darum bemüht, Computer gerade auch zur Analyse nicht-standardisierter Daten einzusetzen, nicht weiter eingehen. Das Auswerten und Generieren der Daten stellt methodisch keine bemerkenswerten Ansprüche, wie sie etwa für ambitionierte Textanalysen qualitativ erhobener Daten bestehen.
Einen knapp gehaltenen Überblick zu internetbasierten Umfragen, die naheliegenderweise von vornherein computergestützt ausgelegt sind, findet man bei Bandilla/ Hauptmanns (Bandilla/ Hauptmanns 1998).(Endnote 12) Bandilla/ Hauptmanns diskutieren drei Techniken zur Datenerhebung: Befragungen per E-Mail, Befragungen in Newsgroups und WWW-Befragungen, wobei ihr Schwerpunkt auf Befragungen per World-Wide-Web liegt. Während bei Befragungen per E-Mail als Vorteile Schnelligkeit, Asynchronizität und Ökonomie hervorgehoben werden und als Nachteil das Aufdrücken der Empfangskosten beim Empfänger, so werden bei Web-Befragungen als Vorteile vor allem die Vorgabe von einfach zu handhabenden Formularen und die mögliche Unterstützung durch Ton- und Videodaten genannt. Als Nachteile von Web-Befragung werden angeführt, dass die zu Befragenden erst einmal an die Web-Seite mit den Fragen gelangen und dann bereit sein müssen, unter Umständen die Kosten für eine rund 30-minütige Onlineverbindung zu tragen.
Den methodisch schwerwiegendsten Nachteil internetbasierter Befragungen sehen die Autoren naheliegender Weise in der fehlenden Repräsentativität der erhobenen Daten. Dieser Nachteil sei nur dann hinfällig, wenn die Befragten und die Grundgesamtheit ihrerseits einen Bezug zu Netznutzern ausweisen. Als Beispiele führ unproblematische Grundgesamtheiten nennen Bandilla/ Hauptmanns "alle Mitglieder einer Organisation, die das Intranet benutzen", "alle Besucher einer Website in einem spezifischen Zeitraum" oder "alle Teilnehmer einer Mailinglist". Sie stellen fest, dass bei Netzbefragungen grundsätzlich keine Zufallsstichproben gezogen werden könnten und die Stichproben immer in vergleichsweise sehr hohem Maße selbstselektierend seien. Insofern lautet das Fazit im Hinblick auf die Hochrechenbarkeit der Daten für die Grundgesamtheit der deutschen Bevölkerung, dass eine generelle Nutzung der Methode 'Online-Befragung' für repräsentative Umfragen z.Z. nicht möglich sei (Bandilla/ Hauptmanns 1998: 42). Im weiteren Teil der Untersuchung widmen sie sich den Internet-Nutzern. Um das Ausmaß der Verzerrungen bei repräsentativ angelegten Netzerhebungen abschätzen zu können, werden charakteristische Unterschiede zwischen der Gruppe der Internet-Nutzer und der restlichen Bevölkerung Deutschlands angegeben.
Wenn man anders als Bandilla/ Hauptmanns nicht auf Befragungen abzielt, die repräsentativ für eine Gesamtbevölkerung sein sollen, kann man in einigen Aspekten zu leicht verschobenen Urteilen gelangen, etwa zum Selbstselektions-Aspekt: Streng betrachtet spielt der Aspekt der Selbstselektion bei allen Formen der Befragung eine Rolle, mit Ausnahme vielleicht gesetzlich verordneter Befragungen. Dieser Aspekt kann deshalb nicht als Besonderheit gegen die elektronischen Formen der Befragung aufgeführt werden. Web-Befragungen sind nur dann in hohem Maße selbstselektiv, wenn öffentlich auf die Befragung hingewiesen wird mit der Bitte, es mögen möglichst viele Menschen die Website mit dem Fragebogen aufsuchen. Hier stimmt das Argument.(Endnote 13) Der Fall liegt aber schon anders, wenn eine Geschäftsleitung sämtliche Mitarbeiter mit einem firmenfinanzierten Netzzugang, gleichgültig ob Intra- oder Internet, dazu aufforderte, an der firmeninternen Web-Befragung teilzunehmen. Wer nicht daran teilnimmt, wird sich rechtfertigen müssen.
Es könnte in dieser Situation Sinn machen, eine Zufallsstichprobe aus den Mitarbeitern zu ziehen und nur die Ausgewählten zur Beantwortung des Fragebogens aufzufordern. Gleiches gilt für E-Mail. So können aus einer Liste von E-Mailadressen sehr leicht durch Zufallsauswahl Adressen gezogen werden, beispielsweise um vor einer Vollerhebung in einer Mailinglist einen Pretest des Fragebogens durchzuführen. Genau so wurde in dieser Befragung verfahren. Darüberhinaus setzt eine Befragung per E-Mail, im Unterschied zu vergleichbaren Befragungen per Web, keine in dem Masse homogene technische und organisatorische Umgebung voraus. Ich vermute deshalb, dass für klassische Formen der Befragung, auf Möglichkeiten nicht-klassischer Formen komme ich anschliessend kurz noch zu sprechen, E-Mail in dieser Bilanz besser als das Web abschneidet, zumal E-Mail mit 97.2% der am häufigsten genutzte Internet-Dienst ist (vgl. Fittkau & Maß 1999).
Bei der Durchsicht der Literatur zu Netzbefragungen fiel auf, dass Befragungen per E-Mail, gemessen an der Anzahl und Umfang der Artikel, in der Forschungsliteratur einen geringeren Stellenwert einnehmen als Befragungen per Web. Ich vermute, dass die Möglichkeiten von E-Mail deshalb unterschätzt werden, weil insbesondere die operativen Fehler bei der Datenerhebung und der Auswertung als zu groß eingeschätzt werden. Denn zweifellos muss der Fehler einer Datenerfassung per Mail größer ausfallen als der bei der Datenerfassung per Web-Formular, bei dem Syntaxfehler von vornherein ausgeschlossen sind.
Wie groß fiel der operative Fehler der vorliegenden Mail-Befragung aus? Die Syntaxfehler, im Sinne von operativ fehlerhaften, nicht maschinell eindeutig auswertbaren Antworten, waren erstaunlich gering. Zählt man allein die als fehlerhaft oder als Mehrfachnennung codierten Antworten in beiden Befragungen zusammen, dann beläuft sich die Gesamtzzahl operativer fehlerhaft beantworteter Fragen auf 107. Das entspricht auf Grundlage sämtlicher Fragen einer Fehlerquote von 0.54%. Im Durchschnitt wurden hiernach von 200 Fragen rund eine Frage technisch nicht trivial auswertbar beantwortet. Allerdings wurden vor der automatischen Kodierung der eingetroffenen Fragebögen diese durchgesehen und in einigen Fällen korrigiert, sofern die Angaben eindeutig interpretierbar, aber für das Auszählprogramm in der Form nicht auswertbar waren. Die genaue Zahl dieser von Hand durchgeführten Korrekturen habe ich leider nicht systematisch erfaßt. Jedoch wurde zu jedem Fragebogen festgehalten, ob die Fragen ausnahmslos syntaktisch korrekt und damit technisch problemlos auszählbar beantwortet wurden. In der ML-Soziologie waren 71.7%, in der ML-Luhmann 51.1% der Fragebögen in diesem Sinne syntaktisch fehlerlos (Ergebnistabelle V64).(Endnote 14) Von diesen Zahlen ausgehend ist insofern eine weitere Abschätzung möglich, wenn pro fehlerhaftem Fragebogen eine bestimmte Anzahl an Syntaxfehlern unterstellt wird. Dieser Überlegung gemäß käme man bei 2 unterstellten Fehlern pro Fragebogen auf eine Fehlerquote von 1.2%, bei drei unterstellten Fehlern pro Fragebogen auf eine Fehlerquote von 1.8 syntaktisch fehlerhaft beantworteter Antworten auf 100 Fragen.
Um die Abschätzung des operativen Fehlers durch worste-case-Angaben noch robuster zu machen, habe ich jede der Antworten der zwei nicht-decodierbaren Mails sowie die der zwei Word-Attachements, weil diese erst von Hand in eine auswertbare Form gebracht werden mussten, als operativ-syntaktisch vollständig falsch (hinzugezählt). Dann beläuft sich die Fehlerquote, bei drei unterstellten Fehlern pro syntaktisch falschem Fragebogen, auf insgesamt 3.1%. Hierbei überwiegen eindeutig die Mehrfachnennungen, die nicht allein als Syntax-Fehler gebucht werden sollten, sondern als Designfehler des Fragebogens. Insofern liegt die operative Gesamtfehlerquote der syntaktisch falsch beantworteten Fragen in dieser Befragung bei maximal 3%.(Endnote 15)
Vor einer Verallgemeinerung dieser Fehlerquote von 3% muss allerdings die Quote verschlechternd in Rechnung gestellt werden, dass eine außergewöhnlich große Zahl an Befragten der beiden Mailinglists den Umgang mit Befragungstechniken gewohnt ist und sich mehr als andere Gruppen den Schwierigkeiten einer automatischen Codierung und Auszählung bewußt sein kann. Zu berücksichtigen ist ferner, dass die Befragten vermutlich außergewöhnlich hoch motiviert und interessiert sein dürften, weil die Ergebnisse der Selbstaufklärung des eigenen Tuns dienlich sein könnten (vgl. Bosnjak/ Batinic 1999). In Befragungen mit einem geringeren in Aussicht gestellten Gewinn für die Teilnehmer, von denen einige zudem unter Umständen zum ersten Mal selbsttätig einen Fragebogen ausfüllen sollten, ist insofern mit einer größeren Syntax-Fehlerquote zu rechnen.
Die bessere Kontrollierbarkeit der Antworten bei Web-Befragungen durch Formularvorgaben ist theoretisch zweifellos gegeben. Aber ob dieser Vorteil praktisch wirklich relevant ist, ist nur schwer zu entscheiden. Ich halte die Fehlerquote der vorliegenden Untersuchung für gering und - im Vergleich zu Kodierungsfehlern bei Übertragungen von klassischen Papier-Befragungen in Datenmatrizen, aber auch im Vergleich zu Web-Befragungen außerhalb geschlossener Benutzergruppen - für absolut vertretbar. Bei Web-Befragungen ist zu berücksichtigen, dass Befragte, wenn sie sich durch Formular-Vorgaben zu sehr eingeengt fühlen, sich auf keine der angebotenen Antworten festlegen mögen. Bei einer Mail-Befragung würden sie sich stattdessen über die Anweisung hinwegsetzen und als Fehler codierte Mehrfachantworten geben. Insofern liesse sich vermuten, dass in Web-Befragungen zwar keine nicht-zugelassenen Mehrfachnennungen auftreten, dafür die Zahl der nicht-gegebenen Antworten relativ höher liegt.
Die syntaktisch-operative Fehlerquote hätte sich in dieser Befragung mit Sicherheit verringern lassen, wenn ...
- im Anleitungstext viel Mühe darauf verwendet worden
wäre zu erklären, dass Mehrfachnennungen nicht zugelassen
sind und zum Ungültigwerden einer Antwort führen.
- im Anleitungstext ferner mit Nachdruck darauf hingewiesen worden
wäre, dass nur ein ASCII-Klartext, und nicht etwas
WinWord-Attachement, zurückgeschickt werden sollen.
- das Auswertungsprogramm erfahrungsgesättigt noch robuster
hätte ausgelegen werden können.
Damit verblieben aus meiner Sicht unter klassischen Befragungsbedingungen als wirklich schwerwiegende Vorteile von Web-Befragungen gegenüber Mail-Befragungen die Möglichkeiten der Nutzbarkeit eines ansprechenden Layouts von Fragen und Anweisungen sowie insbesondere von Multimedia-Optionen (Einspielen von Audio- und Videodaten). Konkurrenzlos attraktiv wären Web-Befragungen dann, wenn die Forscher nicht länger am Papierparadigma festhielten, sondern nicht-klassische dynamische Fragebögen realisierten. Dynamische Fragebögen zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine vom Befragten gegebene Antwort erst auswerten - etwa in Form von Client-Anfragen beim Server oder bei geringem Umfang in Form eines Java-Applet -, bevor sie die nächste Frage präsentieren. Ein solches Vorgehen empfiehlt sich schon in heutigen Client-Server-Umgebungen wie Web-Befragungen, wenn man an Plausibilitätstests oder Filterfragen denkt. Verallgemeinert man die Möglichkeiten von dynamischen Fragebögen, dann liesse sich behaupten, dass sie sich stärker als passive Fragebögen den Befragten anpassten und somit die Eigenkomplexität des Befragten besser im Datensatz abbildeten, etwa vergleichbar dem, was man mit teilstandardisierten Interviews zu erreichen versucht.(Endnote 16)
An diesen Techniken wird gearbeitet. Es deutet sich an, dass eine solche Veränderung der Technik eine Veränderung der Organisation mit sich bringt. Technisch gesehen entnimmt der Forscher die Stimuli eines dynamischen Fragebogens einer Datenbank und muss diese entlang einer komplexen Stimulationsstrategie zusammensetzen. In einem dynamischen Fragebogen liessen sich dann die Fragen und Skalen in ihrer aktuellsten Form in Realtime aus per Internet verbundenen spezialisierten Datenbanken generieren. Für solcher Art permanent methodisch überwachter Stimuli sind, wie es vielfach seit langem schon insbesondere in der Psychologie der Fall ist, Lizenzgebühren zu zahlen. Dadurch können sich, stärker als bislang schon geschehen, neue Formen der Zusammenarbeit und Arbeitsteilung als Dienstleistungen im akademischen Bereich herausmendeln. Allerdings wohl um den Preis, dass zunehmend weniger Fragen überhaupt noch ohne Lizenzabgaben gestellt werden können, zumindest wenn ein professioneller Anspruch gestellt wird.
Endnoten
Endnote 1: Man erhält die Beiträge der ML-Soziologie beispielsweise vom Mai 1997, wenn man an die Listserv-Adresse (listserv@listserv.gmd.de) den Befehl get soziologie log9705 schickt. - zurück -
Endnote 2: Ich danke Martin Recke, der die Beiträge aus der Pre-GMD-Zeit der ML-Soziologie zur Verfügung stellte. Diese Beiträge habe ich mit meinem privaten Datenbestand aus dieser Zeit verglichen, bevor sie dann dem Gesamttextbestand zugefügt wurden. - zurück -
Endnote 3: Ich wurde auf diesen theoretisch interessanten Sachverhalt aufmerksam, weil sich in einigen Fällen ein Subject nach über einem Jahr wiederholte und dadurch die ermittelten Standardabweichungen für die Länge und Dauer von Threads unplausibel wurden und an Aussagekraft verloren. - zurück -
Endnote 4: So sind die Antwortzeiten des Mailservers nicht garantiert und die Anbindung der Teilnehmer kann mit ganz unterschiedlichen Techniken (realtime (Internet-online) oder zeitversetzt (beispielsweise per Poll-Netzanbindung, wie sie im uucp-Netz und Mailboxnetzen üblich ist)) realisiert sein. - zurück -
Endnote 5: Deshalb befindet sich auf der Daten-CD im Verzeichnis "bearbeitet" der ML-Soziologie und der ML-Luhmann eine Datei, die über sämtliche Mailinglistbeiträge hinaus auch die Klassifizierungscodes enthält. - zurück -
Endnote 6: Man erhält die Mitgliederlisten der Mailinglists zugeschickt, wenn man als Mitglied der Liste an die Listserv-Adresse den Befehl review soziologie respektive review luhmann oder review imd-lschickt. - zurück -
Endnote 7: Ich danke Hinrich Kuhls für die Übermittlung der Teilnehmerliste von 9809 und Christian Stegbauer für die Übermittlung der Teilnehmerliste von 9810 und die Teilnehmerzahlen für 9707, 9708 und 9709. Rainer Rilling gebührt Dank für die Teilnehmerlisten der ML-IMD. - zurück -
Endnote 8: Derartige sozial-kommunikative Experimente verbirgt man ohnehin besser hinter Pseudonymen, die für Beobachter nicht erkennbar sind. - zurück -
Endnote 9: Hierbei fiel auf, dass bei der ersten Subscription der Liste überwiegend der Titel im Namen angeführt wurde, der in der nächstfolgenden Anmeldung dann oftmals fehlte. - zurück -
Endnote 10: Die Programme sind in Rexx programmiert und laufen unter Linux. - zurück -
Endnote 11: So hätte bei der vorangestellten Frage der Variablen V5 bis V13, in der nach den hauptsächlichen Motiven für die Subscription der Liste gefragt wird, auf das "hauptsächlich" besser verzichtet werden sollen, wenn anschliessend die Motive vorgegeben werden. - zurück -
Endnote 12: Mittlerweile sind umfangreichere Publikationen zu diesem Thema erschienen z.B. Batinic (vgl. Batinic et al., 1999), Janetzko (vgl. Janetzko 1999) oder Welker (Welker 1999). Hilfreich auch die Untersuchung von 12 Online-Studien bei <e>market - "Rubrik Nutzerzahlen". - zurück -
Endnote 13: Man könnte hierbei eine Beteiligungs- und eine Rücklaufquote unterscheiden Tabelle, wenn man neben den ausgefüllten auch diejenigen Clients, die den Fragebogen zwar aufrufen aber nicht ausfüllen, registrierte. - zurück -
Endnote 14: Sobald sich etwa ein x außerhalb der vorgesehenen Klammer befand, eine Zahl durch einen Textstring wie "ca." ergänzt wurde oder auch eine Mehrfachnennung auftrat, wurde der Fragebogen als "syntaktisch nicht vollständig korrekt" beantwortet taxiert. - zurück -
Endnote 15: Abgerissene bzw. nur teilweise beantwortete und nicht-ausgefüllte Fragebögen müssen hier nicht berücksichtigt werden, weil diese automatisch aussortiert und damit nicht ausgewertet wurden. Hinzukommt, dass dieser Fehler nicht spezifisch nur bei Mail-Befragungen auftritt. - zurück -
Endnote 16: Allerdings könnten unter Umständen die durch dynamische Fragebögen erzielten Ergebnisse sogar besser als die von menschlichen Interviewer ausfallen, da diesem nur eine begrenzte Auffangkapazität zugemutet werden kann, einer Maschine aber unter Umständen große Teile des digitalisierten Weltwissens zur Verfügung steht. - zurück -
6 Die Auswertung
- 6.1 Die Mitglieder der Mailinglists
- 6.1.1 Das Alter der Mitglieder
- 6.1.2 Der akademische Status der Mitglieder
- 6.1.3 Der Frauenanteil unter den Mitgliedern
- 6.1.4 Von welchem PC aus beobachten die Mitglieder das Geschehen der Listen?
- 6.1.5 Wie wurden die Mitglieder auf die Mailinglists aufmerksam?
- 6.1.6 Warum werden diese Mailinglists subscribiert?
- 6.1.7 Wie ist der Umgang mit den Mailinglists?
- 6.1.7 Wie wird die Bedeutung für den wissenschaftlichen Diskurs taxiert?
- 6.1.8 Welche Bedeutung schreiben die Mitglieder den Mailinglist-Debatten zu?
- 6.1.9 Wie beurteilen die Mitglieder das Geschehen in den Mailinglists?
- 6.2 Die Autoren
- 6.3 Die Artikel
6.1 Die Mitglieder der Mailinglists
In diesem Abschnitt gehe ich der Frage nach, wie sich der Kreis der Mitglieder zusammensetzt. Mich interessiert, wie viele Mitglieder die Mailinglists subscribiert haben und wie die monatlichen Zuwachsraten ausfallen, wie die Verteilung der Geschlechter und akademischen Positionen ausfällt und eine ganze Reihe weiterer Fragen dieser deskriptiv-sichtenden Art.
| ML-Soziologie | ML-Luhmann | ML-IMD | |
| Zeitraum | 19.01.1995 - 01.01.99 | 20.11.95 - 01.01.99 | 09.95 - 01.12.98 |
| Mitglieder | 882 | 673 | - |
| Anteil Frauen | 17.63% | 8.77% | - |
| Anteil Uni-Accounts | 42.57% | 38.63% | - |
Der über den gesamten Zeitraum seit Bestehen der Mailinglists gemittelte, geringe Frauenanteil in der ML-Luhmann hat mich am meisten überrascht. Dass sich hier aber in den letzten Jahren etwas getan hat, zeigen zum Vergleich die Zahlen des aktuellen Mitgliederbestands. Die Frage nach dem geringen Frauenanteil verfolge ich gleich weiter. Zunächst wenden ich mich den absoluten Mitgliederzahlen zu.
Um einmal nur grob abzuschätzen, wie hoch der Anteil der gegenwärtig in Deutschland mit Soziologie Beschäftigen liegen mag, der sich in die ML-Soziologie eingeschrieben hat, beschränke ich mich der eindeutigen Datenlage wegen auf die 35222 Studierenden der Sozialwissenschaften im Wintersemester 1996 (bmb+f, Grund- und Strukturdaten 1998/99: 156). Gemäß den Angaben der Befragung beträgt der gegenwärtige Anteil an Studenten in der ML-Soziologie 40%, den ich einmal über die Jahre als konstant annehme. Bezogen auf die 401 Teilnehmer der ML-Soziologie im Dezember 1996 (siehe die nachfolgende Grafik) hatten somit knapp 0.5% der Sozialwissenschaften-Studierenden die Mailinglist für Soziologie subscribiert. (Ergebnistabelle V58)(Endnote 1) .
| Wintersemester | Anzahl | Quelle |
| 1996: | 35222 | bmb+f 98/99: 156 |
| 1995: | 33861 | bmb+f 97/98: 154 |
| 1994: | 29856 | bmb+f 96/97: 160 |
| 1991: | 47714 | nur früh. Bndgebiet, bmbw 94/95: 150 |
| 1990: | 45059 | nur früh. Bndgebiet, bmbw 92/93: 180 |
| 1989: | 41708 | nur früh. Bndgebiet, bmbw 91/92: 160 |
Nun zum monatlichen Zuwachs an Mitgliedern seit Bestehen der Liste bis zum Dezember 1998:
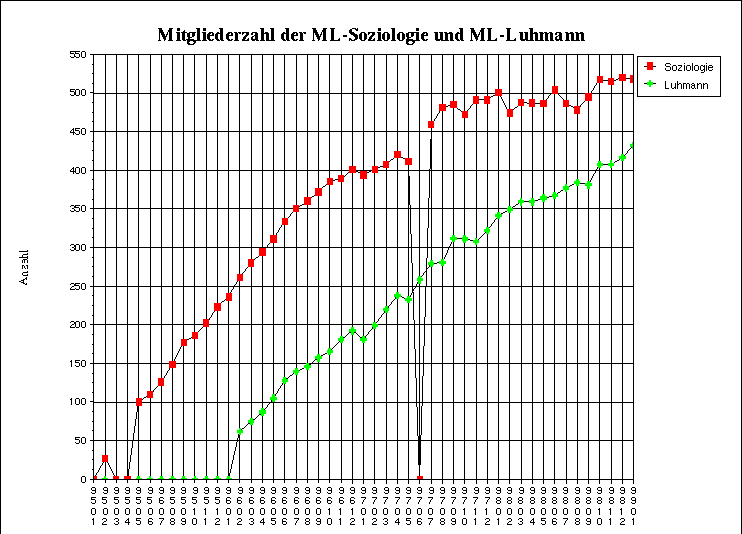
Während in den ersten beiden Jahren die Zahl der Mitglieder pro Jahr in guter Näherung linear zunahm (ML-Soziologie etwa 120 pro Jahr, ML-Luhmann etwa 100 pa), flacht die Kurve seit dem Jahreswechsel 1996/ 1997 in der ML-Soziologie recht deutlich ab, um dann seit August 1997 für einen längeren Zeitraum bei etwa 480 Mitgliedern zu stagnieren. Der Zuwachs an Mitgliedern in der ML-Luhmann hält dagegen recht beständig an.(Endnote 2)
Zieht man zum Vergleich den Zuwachs an Internet-Benutzern heran - der im gesamten Untersuchungszeitraum exponentiell wachsend verläuft, wenn man die Zahl der an das Internet angeschlossenen Server zugrundelegt und die Anzahl der Personen pro Server als konstant annimmt (siehe http://www.cc.gatech.edu/gvu/user_surveys/) -, so drängt sich die Vermutung auf, dass sich die Teilnehmer der Listen eher gezielt themen- und weniger gelegenheitsorientiert in die Mailinglists eintragen. Es spielt hier offenbar mehr eine Rolle, dass die Teilnehmer mit Soziologie bzw. Gesellschaftstheorie befaßt sind, als dass sich ihnen durch Internetzugang eine Gelegenheit bietet, unter diesen günstigen Bedingungen zu beobachten, was Soziologinnen und Soziologen bzw. Systemtheoretikerinnen und Systemtheoretiker umtreibt. Diese Vermutung wird durch die nachfolgend aufgeführten Befunde, insbesondere durch die Ergebnisse der Befragung, erhärtet werden.
Diese These vom spezifischen Interesse an der Thematik der Mailinglist - gegenüber einer bloss guten Gelegenheit, mal hineinzuschnuppern - wird gestützt, wenn man vergleicht, wie viele Mitglieder zugleich in beiden Mailinglists eingeschrieben waren und wie viele von der Existenz der jeweils anderen Mailinglist wissen. Zum Zeitpunkt 1999/01/01 ergab dies eine Schnittmenge von 104 Mitgliedern (ML-Soziologie: 20.1%, ML-Luhmann: 24.6%). Dafür das Luhmann in den Nachrufen zu den "Theoriekönigen" (ZfS vom Dezember 1998) oder "Lichtbringern" (Neue Züricher Zeitung vom 12.11.1998) der Soziologie gekrönt wurde und zweifellos zu "einem der bedeutendsten deutschen Gesellschaftswissenschaftlern der Nachkriegszeit" (TAZ vom 12.11.1998) zählt, ist diese Zahl meiner Ansicht nach erstaunlich gering. Auf die Frage im Fragebogen, ob man die andere Mailinglist kenne, gaben 62.8% der Teilnehmer der ML-Soziologie an, dass sie von der ML-Luhmann wüßten, in der ML-Luhmann wußten 45.5% von der Existenz der ML-Soziologie (Ergebnistabelle V28).
6.1.1 Das Alter der Mitglieder
Die Befragten der ML-Soziologie sind mit durchschnittlich 34.3 Jahren um ein Jahr jünger - es handelt sich allerdings um keine signifikante Differenz -, wenn auch altersmäßig etwas heterogener zusammengesetzt, als die Befragten der ML-Luhmann (Ergebnistabelle V60). Damit liegen diese Zahlen sehr nahe denen, die für Internet-Nutzer generell gelten: Bei ausschließlich privaten Nutzern liegt der Mittelwert bei 35.7 Jahren. Rechnet man noch diejenigen hinzu, die ausschließlich im Beruf über einen Internetzugang verfügen, sind es 36.8 Jahre (vgl. Fittkau & Maß 1999).
6.1.2 Der akademische Status der Mitglieder
Das Ergebnis einer früheren Studie zur ML-Soziologie (vgl. Rost 1996d), in der die Mitglieder nach ihrem akademischen Status befragt wurden, ergab folgende Verteilung (Gesamtzahl der TeilnehmerInnen: 101 bei einer Rücklaufquote von 32%):
| akademischer Status | Anteil |
| Soziologen und Soziologie-Studierende | 83% |
| Nicht-soziologisch ausgeb. Akademiker/ Studierende | 12% |
| Laien | 5% |
| Lehrstuhl für Soziologie-Inhaber | 2% |
| Akademischer Mittelbau (Dipl./ Mag./ Prom./ Habil.) | 57% (davon 88% Soz) |
| Studierende | 37% (davon 84% Soz) |
Für die vorliegende Studie wurde das Kategorienset zur Ermittlung des akademischen Status klarer unterschieden und höher aufgelöst. (Ergebnistabelle V58)
| akademischer Status | ML-Soz msBzS | ML-Soz osBzS |
| Professur | 3% | 4% |
| Habilitation | 1% | 4% |
| Promotion | 19% | 15% |
| Diplom/ Magister | 38% | 33% |
| Studium | 40% | 30% |
| ohne akad. Bezug | - | 15% |
| Gesamt | 101% | 101% |
Vergleicht man zunächst die aktuellen Zahlen der ML-Soziologie mit denen von 1996, so stellt man eine nur ganz leichte Verschiebung fest, die man statistisch kaum Ernst nehmen darf.(Endnote 3) Noch am deutlichsten nimmt offenbar der Anteil der nicht-akademischen Laien in der ML-Soziologie ab, von ehemals 5% auf nunmehr 2% (gemittelt über die beiden Kategorien msBzS und osBzS), der durch die anteilige Zunahme eher von den Lehrstuhlinhabern und Studierenden als dem Mittelbau ausgeglichen wird. Dieser Befund einer solch geringen Dynamik überrascht. Ich hätte eine wesentlich eindeutiger erkennbare Veränderung zugunsten des Anteils akademisch-etablierter Mitglieder erwartet und auf keinen Fall sogar noch eine tendentielle Zunahme des Anteils der Studierenden.
| akademischer Status | ML-Luh msBzS | ML-Luh osBzS |
| Professur | 9% | 5% |
| Habilitation | 1% | 5% |
| Promotion | 24% | 21% |
| Diplom/ Magister | 29% | 41% |
| Studium | 37% | 20% |
| ohne akad. Bezug | - | 8% |
| Gesamt | 100% | 100% |
Bemerkenswert an der aktuellen Verteilung ist, dass die Luhmann-Liste zu 41% von Nicht-SoziologInnen subscribiert wurde, die allerdings zu einem Anteil von 72% (ML-Soziologie: 55%) einen gefestigten akademischen Status innehaben. Über ein Drittel der befragten Mitglieder der ML-Luhmann verfügen mit Bezug zur Soziologie über einen zumindest promovierten Status, gegenüber einem knappen Viertel in der ML-Soziologie.
6.1.3 Der Frauenanteil unter den Mitgliedern
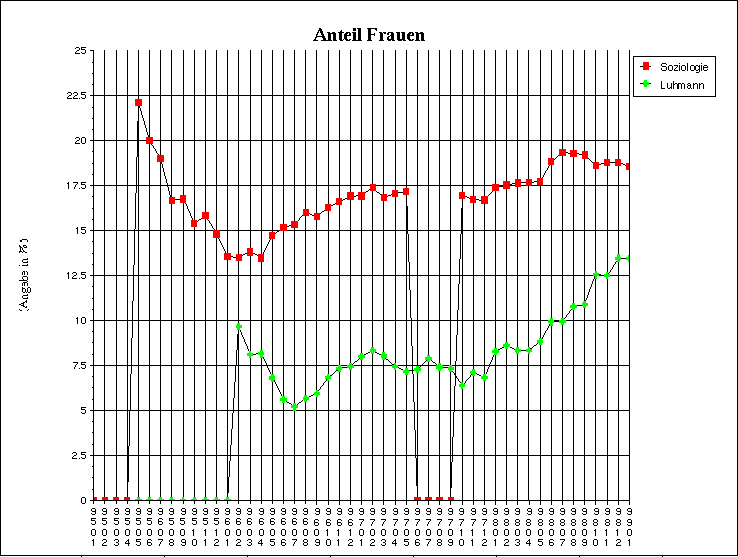
| Liste | ML-Soziologie | ML-Luhmann | ML-IMD |
| Zeitpunkt | 01.01.1999 | 01.01.1999 | 01.12.1998 |
| Mitglieder | 518 | 432 | 321 |
| Anteil Frauen | 18.6% | 13.5% | 13.0% |
| Anteil Uni-Account | 44.4% | 36.1% | 39.6% |
In allen drei Listen nimmt der Frauenanteil zwar tendentiell zu, doch das Niveau der absoluten Zahlen ist niedrig. Dieser Befund muss erstaunen, auch wenn er nicht überrascht. Vergleicht man die Frauenanteile, dann zeigt sich, dass die ML-Soziologie mit einem Anteil von über 22% startete, dann innerhalb des folgenden Jahres auf 13% sackte und seitdem mit einer leichten Tendenz stetig nach oben zeigt. Einen ähnlichen Verlauf weist die ML-Luhmann auf, allerdings mit einem absolut weitaus geringeren Frauenanteil. Während in der Frühzeit der Liste der Anteil 10% betrug, sackte der Anteil innerhalb eines halben Jahres auf knapp 5%, oszillierte dann gut zwei Jahre lang zwischen 7% und 8% und weist erst seit Anfang 1998 eine stetige Tendenz nach oben auf. Diese Zahlen sind insofern bemerkenswert und erklärungsbedürftig, weil allein der Anteil an Studentinnen der Sozialwissenschaften über 50% beträgt (für 1996: 17950 Studentinnen zu 17272 Studenten, Quelle: bmb+f, Grund- und Strukturdaten 1998/ 1999) und selbst der ohnehin geringe Anteil der weiblichen Habilitierten 1996 mit 12.3% höher liegt.
Setzt man den Zuwachs des Frauenananteil in den letzten Monaten ins Verhältnis zur relativen Abnahme der Mitglieder insgesamt, dann ist diese Entwicklung vermutlich weniger als ein verstärktes Drängen nun auch der Frauen in die Mailinglists zu interpretieren, als vielmehr als ein Nachlassen des Drängens der Männer.
Die Angaben zum Frauenanteil unter den Internet-Nutzern ganz allgemein lag 1995 bei 6%, im Herbst 1998 bei 17% (siehe: iX 1999/02: 16). Allerdings ist diese Angabe problematisch, wenn man den weiblichen Anteil der Internet-Nutzer in den wenigen vertrauenswürdigen Studien vergleicht. Der Frauen-Anteil wird in anderen Befragungen, die sich, so weit ersichtlich, alle auf 1997 beziehen, mit 12% (W3B-Umfrage), 15% (3-Länder-Umfrage), 20% (Umfrage der Uni Leipzig), 27% (ARD-Online) und 28% bis 32% (Academic Data) angegeben (Bandilla/ Hauptmanns 1998: 45f). Der Anteil der Frauen, der den Fragebogen im März 1999 beantwortete, betrug in der ML-Soziologie 23.4%, in der ML-Luhmann 13.7% (Ergebnistabelle V61).
Die Zahlen belegen, dass die durch die neuen Informations- und Kommunikationtechniken geschaffenen Spielräume von Frauen weitaus weniger genutzt werden als von Männern, obwohl die bestehenden Netzforen für beide Geschlechter gleichermaßen zugänglich sind. Weder an den PCs der Schulen noch an denen der Hochschulen noch am heimatlichen PC dürften sich strukturelle Hindernisse dafür finden lassen, dass Frauen von vornherein weniger mit Computern und Netzen in Berührung kommen als Männer. Auch die Vermutung einer fehlenden Bereitschaft zur Nutzung von Computern kann hier nicht überzeugen, da der Übergang von der Schreibmaschine zum Computer im akademischen Bereich inzwischen weitgehend vollzogen sein dürfte. Woran es offenbar aktuell hauptsächlich noch mangelt, ist die theoretische und praktische Bereitschaft, den Übergang vom Computer zum Netz zu vollziehen. Am wahrscheinlichsten erscheint mir deshalb die These, dass Frauen vor allem sich selbst vom Gebrauch elektronischer Foren ausschliessen und nicht etwa unmittelbar sozial ausgeschlossen oder zumindest behindert werden. Worin nun die ungleichen Bereitschaften begründet liegen und welche sozialen Bedingungen dafür die Voraussetzung abgeben, darauf kann an dieser Stelle keine überzeugende Antwort gegeben werden. Ebensowenig liesse sich mit Bestimmtheit sagen, ob diese Ungleichverteilung dauerhafte Züge annehmen wird. Es ging lediglich darum, für die Erstaunlichkeit und Erklärungsbedürftigkeit der festgestellten Ungleichheit sensibel zu machen.
Weil auf die Frage nach den Gründen für die geringe Repräsenation von Frauen in den untersuchten Listen zum Zeitpunkt der Fragebogenerstellung keine befriedigende Antwort zu finden war, interessierten mich die Meinungen der Mitglieder zu diesem Problem (Ergebnisse V62). Die frei gegebenen Antworten wurden für jede Mailinglist kategorisiert und anschliessend ausgezählt.
| ML-Soziologie | ML-Luhmann | |
| Absolute Anzahl der insgesamt beantworteten Fragebögen: | 173 | 143 |
| Diese Frage haben beantwortet: | 61.3% | 60.8% |
| Die Anzahl der Thesen: | 123 | 99 |
Die unterschiedlichen Anteile von Frauen und Männern in den Mailinglists haben die Teilnehmer mit folgenden Thesen erklärt:
| Thesen | ML-Soz. | ML-Luh. |
| 1. Unterschiedlich ausgebildete Interessen und Kenntnisse an Computern: | 42% | 17% |
| 2. Unterschiedlich ausgebildete Interessen an und Kenntnisse zur Theorie: | 3% | 40% |
| 3. Unterschiedliche Vertretung der Geschlechter im akademischen Bereich: | 15% | 9% |
| 4. Bekundung, nicht zu wissen, wie dieser Unterschied zu erklären ist: | 11% | 7% |
| 5. Unterschiedlich ausgebildete Präferenzen für face2face-Kommunikation: | 9% | 2% |
| 6. Unterschiedliche Verfügung über Ressourcen wie Zeit und Geld: | 2% | 5% |
| 7. Unterschiedliche Sozialisation der Geschlechter: | 4% | 1% |
| 8. Frauen werden durch die Dominanz der Männer in der Liste abgeschreckt: | - | 5% |
| 9. Frauen sind generell weniger in den elektronischen Netzen vertreten: | 4% | - |
| 10. Die ML-Soz. komme dem Drang der Männer zur Selbstdarstellung entgegen: | 3% | - |
| 11. Die ML-Soziologie ist nicht so interessant und ertragreich: | 2% | - |
| 12. Bekundung, dass die Differenz nicht weiter wichtig genommen werde: | - | 2% |
| 13. Weitere, nicht aggregierbare Antworten: | 5% | 11% |
Die beiden insgesamt am häufigsten gewählten Erklärungen führen den deutlich geringeren Frauen-Anteil in den Mailinglists demnach zum einen auf unterschiedliche Interessen und Kenntnisse im Bereich der Computertechnik und zum zweiten, speziell in der Luhmann-Liste, auf unterschiedliche Theorieinteressen und -kenntnisse von Männern und Frauen zurück. Dabei reicht das Spektrum der Thesen zum Verhältnis von Geschlecht und Computertechnik von der Annahme, dass Frauen im geistes- und sozialwissenschaflichen Bereich generell weniger an Informationstechnik interessiert seien bis hin zur Unterstellung einer allgemeinen "Technikphobie", die Frauen insgesamt zuzuschreiben sei. Die Spannweite der Thesen hinsichtlich des ungleich verteilten Theorieinteresses reicht von der Annahme, dass Frauen generell weniger Theorieinteressen und -kenntnisse ausbilden bis hin zu Aussagen dass sich Theorieinteressen und Kenntnisse auf andere Bereiche bezögen.
In den Antworten beider Listen werden kaum mehr unmittelbare strukturelle Zwangsverhältnisse und Hindernisse als Erklärung für die bestehenden Unterschiede der Geschlechteranteile in den Listen herangezogen. Statt dessen beziehen sich die Erklärungen primär auf den Bereich der Wirksamkeit subjektiver Unterschiede. Dabei bestehen allerdings deutliche Unterschiede in den favorisierten Angaben zwischen beiden Listen. Es werden wenig überraschend solche Erklärungen bevorzugt, die durch den thematischen Rahmen der jeweiligen Mailinglist nahegelegt werden. Dass in der ML-Soziologie, im Unterschied zur ML-Luhmann, die These unterschiedlich ausgebildeter Theoriekenntnisse und Interessen kaum eine Rolle spielt, hängt vermutlich damit zusammen, dass diese Liste von ihren Mitgliedern nicht als ausgesprochene Theorieliste, sondern eher als Serviceliste begriffen wird.(Endnote 4)
Womöglich ist die dürre These am plausibelsten, dass Frauen womöglich stärker vom unmittelbaren Nutzen überzeugt sein müssen, bevor sie sich auf eine neue Technik oder ein neues Verfahren einzulassen bereit sind. So heißt es in einer aktuellen Meldungen des Heise-Newstickers vom 30. Mai 2000:
"Frauen nehmen Online-Shopping in die Hand
Während in deutschen Landen Initiativen wie -Frauen ans Netz- noch darum kämpfen, das Internet zur Hälfte mit weiblichem Leben zu füllen, ist man in den USA schon ein gutes Stück weiter: Die 50-Prozent-Hürde unter der Internet-Bevölkerung haben die Frauen schon genommen. Zudem dürfte das, womit sich überproportional viele Frauen im Web beschäftigen, genau den Geschmack der neuen "Internet-Gestalter" aus Wirtschaft und Politik treffen: Einkaufen. Nach einer Studie der Gruppe http://www.peoplesupport.com/ stellen Frauen 63 Prozent der Online-Shopper; vor einem Jahr waren nach Erkenntnissen einer von CommerceNet und Nielsen Media Research durchgeführten Studie nur 38 Prozent aller US-amerikanischen und kanadischen Surfer, die übers Web eingekauft haben, weiblich.Warum mehr Frauen als Männer das Web als Einkaufsparadies nutzen, liegt für Lance Rosenzweig, Chef von PeopleSupport, auf der Hand. "Frauen sind traditionell verantwortlich für 80 Prozent der Einkäufe in ihrem Haushalt. Wenn mehr Einkäufe online stattfinden, werden Frauen in dieser Welt ebenfalls die Verantwortung dafür übernehmen." Mit solchen Tendenzen gehe auch eine Änderung der Internet-Landschaft einher. So hat im letzten Jahr eine Reihe frauenorientiert Web-Sites ihre Pforten geöffnet, etwa Women.com, Oprah Winfreys Oxygen.com oder Style.com. Rein demographisch unterscheiden sich die weiblichen Netizens nicht sehr von ihren männlichen Surf-Genossen, weiß die Studie aber zu berichten. Typischerweise seien Online-Shopperinnen zwischen 45 und 54 Jahren alt, verdienen mehr als 75.000 US-Dollar, sind weiß und haben Kinder."
Als ein kurzes Zwischenfazit auf Basis dieser sozialstrukturellen Fragestellungen liesse sich sagen, dass die Zusammensetzung der Mitglieder den diskursiven Zusammenhang zwischen den formal Bildungsungleichen verdichtet. Es kommt zu einer kommunikativen Aufhebung der strikten Rollentrennung von akademischem Lehrer und Schüler. Es werden Erfahrungen mit dialogischen Umgangsformen gesammelt in einer Situation, in der mit einem traditionellen Bildungstitel nicht notwendig zugleich auch ein privilegierter Wissensanspruch und die gesellschaftlich adäquate Fähigkeit zu lernen erhoben werden kann. Die geringe Zahl an Mitgliedern deutet darauf hin, dass die Mitgliedschaft in einer Mailinglist jedoch noch weit davon entfernt ist, als akademische Normalität gelten zu können. Das Durchschnittsalter der Mitglieder zeigt, dass es sich vorwiegend um Mitglieder um die 35 Jahre handelt, von denen die Angebote der Liste genutzt werden. Diese stehen nicht mehr am Anfang ihrer intellektuellen Entwicklung, wohl aber, wie die Verteilung der Bildungstitel zeigt, noch am Beginn ihrer akademischen Laufbahn. Diese Konstellation bedeutet eine Position, in der der Zwang und die Bereitschaft zu intellektueller Produktivität besonders hoch sind. Dies läßt vermuten, dass hier bei den Protagonisten eine besonders hohe Aufnahmebereitschaft vorliegt, die zu der Erwartung führt, dass die Ergebnisse von Mailinglistkommunikationen im bestehenden Wissenschaftssystem durchaus einflußreicher sind als die geringe Reputation einer Mailinglist und die relativ kleine Zahl an Mitgliedern nahelegen.
6.1.4 Von welchem PC aus beobachten die Mitglieder das Geschehen der Listen?
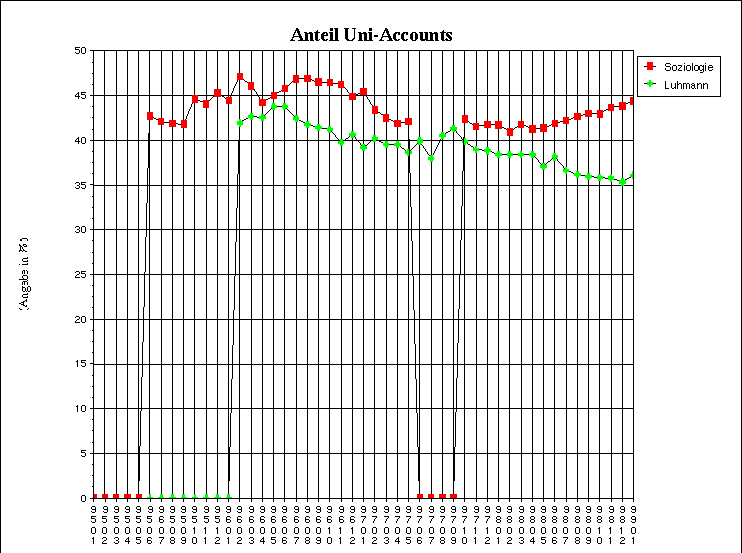
Zählt man anhand der E-Mailadressen der Mitglieder die Hochschul-Accounts aus, dann schwankt der Anteil in der ML-Soziologie beständig zwischen 41% und 47%, während er in der ML-Luhmann inzwischen unter 40% liegt und mit einer klaren Tendenz nach unten zeigt.
Für Mitglieder von Hochschul-PC aus fallen die ökonomischen und technischen Teilnahmekosten relativ am geringsten aus, weil sie hierfür zumeist auf die Wartungsspezialisten der Hochschule zurückgreifen können. Am teuersten ist die Teilnahme für diejenigen, die sowohl vom Büro-/Rechnerpool-PC als auch privat auf die Liste zugreifen können. Unter den Befragten der ML-Soziologie ist das bei 20.8%, unter denen der ML-Luhmann zu 23.8% der Fall. Die meisten Befragten haben sich allerdings ausschließlich von ihrem Privat-PC aus eingeschrieben (S: 38.2 / L: 40.6%), gefolgt von der Teilnahme ausschließlich vom Büro-PC aus (S: 31.2%/ L: 30.8%). Die geringste Rolle spielt die Subscription ausschließlich vom Rechnerpool-PC aus (S: 8.1 / L: 3.6%) (Ergebnistabelle V2).
6.1.5 Wie wurden die Mitglieder auf die Mailinglists aufmerksam?
Eindeutig die meisten Befragten wurden durch die "gezielte Recherche im Netz" (S: 35.5% / L: 39.9%) auf die Mailinglist aufmerksam, gefolgt vom "Hinweis durch Kollegen" (S: 19.2% / L: 28.7%). Keine Rolle spielen dagegen "Netz- und Computerschulungen" (Ergebnistabelle V1).
Dieser Eindruck, dass Computer- und Netz-Schulungen kaum eine Rolle spielen - und dass es offenbar auch gar keine relevanten Angebote für speziell am Fach ausgerichtete Schulungen gibt (oder zumindest sind sie, falls es sie gibt, nicht so attraktiv, dass sie genutzt würden) -, verstärkt sich, wenn man die Antworten auf die Frage, wie der Einstieg in den Umgang mit Computernetzen gefunden wurde, durchsieht. Die Hauptantwort lautet hier: "Durch Ausprobieren am PC ohne Buch" (Ergebnistabelle V56). Dabei zeichnet sich ein kleiner Unterschied zwischen den beiden Listen ab: Während in der ML-Soziologie überwiegend am Büro-/Rechnerpool-PC ohne Buch probiert wird (25.2%, Ausprobieren am Privat-PC ohne Buch: 24.6%), überwiegt in der ML-Luhmann das Ausprobieren am Privat-PC ohne Buch (33.1%, Ausprobieren am Büro-/Rechnerpool-PC ohne Buch: 24.5%). Eindeutig keine Rolle spielen Schulungen, wie sie etwa von den in der Regel privat zu bezahlenden Volkshochschulen angeboten werden, immerhin eine kleine Rolle spielen von Uni oder Arbeitgeber bezahlte Schulungen (S: 5.6% / L: 6.5%).
Etwas überraschend ist der geringe Anteil der Einweisungen durch Kollegen oder Freunde (S: 13.5% / L: 9.35%), die mit entscheidenden Tips weiterhelfen. Die zumeist persönliche Einweisung durch bereits Erfahrenere (sowie durch Schulungen aus dem Umfeld des Rechenzentrums oder des Informatik-Instituts für einen bereits leidlich eingewiesenen Nutzerkreis) spielte zu den Pionierzeiten der Netznutzung Anfang der 90er Jahre dagegen eine große Rolle, einfach deshalb, weil es kaum Netzanwendungs-Literatur gab und die Thematik so neu und Bedienung der Programm so kryptisch war, dass man durch bloßes Ausprobieren kaum weiterkam.(Endnote 5) Insofern läßt sich dieser geringe Anteil der persönlichen Einweisung durch Experten und Schulungen als ein Indiz dafür nehmen, dass die Pionierzeiten der Netznutzung vorbei sein könnten. Man kommt offenbar auch ohne Einweisungen durch Probieren zu befriedigenden Ergebnissen. Dass die Pionierzeiten der Netznutzung auch dem Selbstverständnis nach zuende sind, zeigt sich darin, dass sich in der ML-Soziologie 65.5%, in der ML-Luhmann 78.3% der Befragten nicht als Pioniere der Netznutzung sehen (Ergebnistabelle V54).
Es läßt sich allerdings bezweifeln, ob die Netz-Technik inzwischen tatsächlich so anwendungsfreundlich ausgelegt ist, dass man durch bloßes Ausprobieren in kurzer Zeit zu einem hinreichenden Anwendungs-Know-How gelangen kann. Vermutlich gibt es in den Mailinglists einen recht hohen Anteil an Mitgliedern, die mit ihren Netzprogrammen nur unbeholfen umzugehen wissen. Ein Hinweis dafür gibt die große Anzahl an fehlerhaft zugeschickten Antwort-Mails und die insgesamt sieben Befragten, die sich nicht in der Lage sahen, im Fragebogen ein x zwischen den eckigen Klammern einzufügen. Wie sich herausstellte, war diesen nicht klar, dass sie zuvor mit Reply hätten antworten müssen, damit der Fragebogen bearbeitbar in den Editor geladen wird. Immerhin sahen sich diese sieben Befragten aber in der Lage, eine Mail zu verschicken, um auf den vermeintlichen Mißstand hinzuweisen - es wird vermutlich einige Befragte gegeben haben, die nicht einmal dazu in der Lage waren. Und immerhin sind diese sieben bereits Mitglieder einer Mailinglist. Ich beobachte in meiner Umgebung, dass es bei gegebenem hohen inhaltlichen Interesse und vorhandener Technik durchaus Monate und sogar Jahre dauern kann, bis jemand seine technische Unsicherheit überwindet und sich in eine Mailinglist einschreibt. Die Anwendungsprogramme sind inzwischen so ausgelegt, dass man durch Probieren zumeist zu ersten Erfolgen kommt und der Lernmodus des Ausprobierens auf Dauer nicht entmutigt wird. Aber es ist erfahrungsgemäß noch immer für viele Anwender ein Problem, beispielsweise Grafiken oder Texte zu verschlüsseln oder auch nur so zu verschicken, dass der Empfänger beim Dekodieren keine technischen Schwierigkeiten bekommt. So wird von den meisten Anwendern, wenn sie Texte verschicken möchten, beim Empfänger beispielsweise die Verwendung des Textverarbeitungsprogramms WinWord einfach vorausgesetzt, wobei vielen schlicht nicht klar ist, dass das Dateiformat von Word nicht einmal zu sich selbst kompatibel ist.(Endnote 6) Selbstverständlich sind technische Unzulänglichkeiten nicht den Anwendern zuzurechnen, vielmehr geht es um die Kompetenz, unter widrigen Umständen, in denen Ausprobieren zu lange dauert, durch Wissen funktionierende Workarounds zu finden.
Dass eine effiziente Ausbildung an den Maschinen ganz offenbar eine geringe Rolle spielt, läßt sich insgesamt als Indiz dafür werden, dass dieses Medium nicht Ernst genommen wird und unter den wissenschaftlichen Kommunikationsmedien keine relevante Position einnimmt. Man kann es sich bislang ungestraft leisten, sich in den neuen Medien unbehende zu zeigen. Legt man den Grad der institutionalisierten Ausbildung als Maßstab zugrunde, so kann man zu dem Schluss gelangen, dass die Pionierzeiten der Netznutzung noch nicht beendet sind. Bislang darf jeder selber zusehen, wie er klarkommt. Der Bedarf an institutionalisierter, gar fachausgerichteter Ausbildung an den Kommunikationsmaschinen für WissenschaftlerInnen wird offenbar nicht gesehen oder wird in den Prioritäten als so niedrig eingestuft, dass Geld dafür nicht in hinreichendem Maße zur Verfügung steht. Es arbeiten, um die Situation vollmundig zu zeichnen, überwiegend ungelernte Arbeiter an den Informations- und Kommunikationsmaschinen.
Ein weiteres Indiz dafür, dass Textverarbeiter trotz des Technikeinsatzes unter faktisch wenig professionellen Bedingungen arbeiten, zeigt sich im technischen Umgang mit aufbewahrenswerten Beiträgen (Ergebnistabelle V16). Man muss gar nicht erst per Kreuztabelle die Wissenschaftler von den Laien trennen, zu eindeutig sind die Zahlen. In beiden Listen speichern die Befragten solche Beiträge überwiegend in einem eigens dafür eingerichteten Verzeichnis ab (S: 43.3% / L: 41.1%) oder belassen sie im Mail-Verzeichnis (S: 21.6% / L: 22.7%). Und ein durchaus nennenswerter Anteil der Befragten druckt gute Beiträge aus (S: 12.9% / L: 19.2%). Keine Rolle (über drei Items zur (teil)automatisierten Weiterverarbeitung von Artikeln aggregiert, beträgt der Anteil in der ML-Soziologie 1.17% und in der ML-Luhmann: 2.84%) spielen dagegen Automatismen, die die Weiterverarbeitung solcher Beiträge durch eine höher auflösende Organisation der Daten erleichtern. Obwohl es technisch naheliegt, wenig bis keine Mühe und kein Geld kostet, werden archivierwürdige Beiträge demnach weder von Hand noch automatisiert einem lokalen Informationssystem zugefügt. Ebenso wird auf die Vorteile eines Volltext-Indexierers verzichtet, mit dessen Hilfe der gesamte Textdatenbestand einer Festplatte anhand von Stichworten automatisiert durchsucht werden kann und dessen Installation und Anwendung trivial ist. Solche Programme stehen nicht nur unter Linux, sondern auch unter anderen Betriebssytemen zur Verfügung - und wenn nicht, wäre das ein hinreichender Grund zu erwägen, das Betriebssystem zu wechseln. Man darf vermuten, dass einige Mitglieder die Beiträge zumindest so abspeichern, dass die Dateinamen der abgespeicherten Beiträge instruktiv formuliert sind und dass bei Recherchen hin und wieder auf solche Dateiendurchsuchprogramme wie grep zurückgegriffen wird. Selbstverständlich ist in Rechnung zu stellen, dass es hier vielfach an Wissen mangelt und die Mitglieder auf das angewiesen sind, was ihnen die Werbung verspricht - womit wieder die schlechte Ausbildungssituation im Umgang mit modernen Kommunikationsmaschinen angesprochen ist.
Wenn man diese Ergebnisse betrachtet, könnte man meinen, dass es um die oben formulierte Industrialisierungsthese nicht gut bestellt sei, schließlich arbeiten die meisten der befragten Mitglieder an ihren vernetzten PCs im Modus besserer Schreibmaschinensimulationen.(Endnote 7) Die Industrialisierung der Mitteilungsverarbeitung findet objektiv statt, sei es in Form der Automatisierung von Verwaltungsvorgängen, sei es in Form von e-commerce oder in Form der Installation von Workflow- oder Groupware-Applikationen. Nur hat diese Entwicklung bislang die Wissenschafts-Organisationen, speziell die im sozialwissenschaftlichen Bereich, offenbar noch nicht im vollen Maße erreicht. Das Ausmaß der Hochschulkrise ist somit sicher noch steigerbar.
6.1.6 Warum werden diese Mailinglists subscribiert?
Dieses soeben festgestellte geringe Niveau der Automatisierung überrascht insofern, weil für die Mehrzahl der Befragten das Hauptmotiv zur Subscription einer Mailinglist ganz eindeutig darin besteht, die Beiträge der Mailinglist für die eigene Arbeit verwerten zu können (S: 89% / L: 92.2%) (Ergebnistabelle V8). Es läge also nahe, ein leistungsfähiges Archivsystem anzustreben. Recht hoch ist ebenso der Anteil derjenigen, deren Motiv darin besteht, beobachten zu können, ob andere Mitglieder am gleichen Thema arbeiten (S: 84.5% / L: 78.4%) (Ergebnistabelle V10). Als nicht ganz so wichtig wie die Verwertung von Mailinglist-Beiträgen und die Suche nach Konkurrenten/ Gleichgesinnten wird die Möglichkeit eingestuft, sich per Mailinglist aktiv und möglichst schnell an Expertinnen wenden zu können (S: 64.3 / L: 61.5) (Ergebnistabelle V9).
Ein weiteres vorgegebenes Motiv war die Unterstellung, dass Mitglieder ihre selbstentwickelten Thesen in der Mailinglist ausprobieren möchten. Dieses Motiv wurde in der ML-Soziologie von 29.3% der Befragten als zutreffend bezeichnet, in der ML-Luhmann von 45.9% (Ergebnistabelle V7). Einen ähnlich signifikanten Unterschied zwischen den beiden Listen gab es beim Motiv, ohne spezifische Absichten beobachten zu können, was die Mailinglist zu bieten hat: In der ML-Soziologie gaben das 70.7%, in der ML-Luhmann 51.1% der Befragten an (Ergebnistabelle V12). Eine nur geringe Rolle spielt das Motiv, beobachten zu können, ob die eigenen Publikationen in den klassischen Medien in der Mailinglist eine Rolle spielen (S: 11.5% / L: 17%) (Ergebnistabelle V11). Insgesamt weisen diese Zahlen darauf hin, dass die Mitglieder der ML-Luhmann mit spezifischer ausgerichteten Motiven am Geschehen der Mailinglist teilnehmen als die ML-Soziologie-Mitglieder.
6.1.7 Wie ist der Umgang mit den Mailinglists und wie wird deren Bedeutung für den wissenschaftlichen Diskurs taxiert?
Auf die Frage, wie häufig die Mitglieder das Geschehen in den Mailinglists verfolgt, antworteten rund Dreiviertel der Befragten, dass sie die Beiträge der Listen mehrmals pro Woche lesen (Ergebnistabelle V28).
Es erscheint plausibel, hier einen Zusammenhang zwischen der Beobachtung der Mailinglist und dem Ort (Privat-PC oder Büro-PC) zu vermuten, von dem aus die Mailinglist subscribiert wurde. Wenn jemand ohnehin täglich am Büro-PC arbeitet, der in der Regel über eine Standleitung an das Internet angebunden ist, dann kann er kaum umhin wahrzunehmen, wenn eine Mail eintrifft. Mitglieder, die von Privat- oder Rechnerpool-PCs aus eingeschrieben sind, müssen dagegen in der Regel mehr Aufwand (Kosten oder Zeit) inkaufnehmen, um an ihre Mails zu gelangen. Es liegt nahe, die Höhe des betriebenen Aufwands für einen Indikator der Ernsthaftigkeit des Interesses zu interpretieren.
Befragt nach einem Urteil über das Artikelaufkommen in der Mailinglist, antworteten die Befragten beider Listen unterschiedlich. Während 30.8% der Befragten der ML-Soziologie meinten, dass ruhig noch mehr Artikel am Tag eintreffen könnten, so teilten diese Auffassung in der ML-Luhmann nur 12%. In beiden Listen stimmt rund ein Drittel darin überein, dass das Artikel-Aufkommen optimal sei. Der größte Anteil der Antworten entfiel auf 39.4% der ML-Luhmann-Befragten, denen das Artikelaufkommen gleichgültig ist (Ergebnistabelle V15).
Ist diese Gleichgültigkeit gegenüber der Menge an Beiträgen womöglich gleichzusetzen mit einer Gleichgültigkeit gegenüber der Mailinglist oder gegenüber den Inhalten, die man ohne sonderliches Interesse wahrnimmt? Oder zeigt sich mit diesem Statement eine gewisse Abgeklärtheit, dass es einen anderen als selektiven Modus des Lesens von Beiträgen gar nicht geben kann, so dass Gleichgültigkeit gegenüber dem Aufkommen naheliegt?
Zunächst zur Frage des Auswahlmodus für Beiträge. Die meisten Befragten überfliegen jeden eintreffenden Beitrag, um sich dann für eine intensivere Lektüre zu entscheiden (S: 52.9% / L: 44.4%). Andere achten auf ein "interessantes Subject", bevor sie sich zum Lesen entschliessen (S: 38.2% / L: 38.7) (Ergebnistabelle V17). Ich hatte darüber hinaus eigentlich erwartet, dass ein großer Anteil der Mitglieder Beiträge bevorzugt autororientiert auswählt. Gegenwärtig scheint dieses Kriterium jedoch bei den Mitgliedern beider Mailinglists keine bedeutsame Rolle zu spielen (S: 0% / L: 2.8%). Ich werte dieses mich überraschende Ergebnis - zusammen mit dem Befund, dass die meisten Befragten versuchen, möglichst jeden Beitrag zumindest zu überfliegen -, als Indiz dafür, dass das Artikelaufkommen in den beiden Listen als gering einzustufen ist. Zieht man zum Vergleich Newsgroups mit mehreren Hundert Beiträgen am Tag heran, in denen es unmöglich ist, tatsächlich jeden Beitrag zu lesen, dann spielen die Namen von Text-Qualität versprechenden Autoren bei der Auswahl der Artikel sehr wohl eine große Rolle.(Endnote 8)
Dass in der ML-Luhmann eher keine Gleichgültigkeit gegenüber den Inhalten der Beiträge vorherrscht, zeigt sich an der Zeit, die die Befragten mit der Lektüre der Beiträge verbringen. Wenn sich jemand den Beiträgen der Mailinglist zuwendet, so sind dies im Schnitt in der ML-Soziologie 6.6 Minuten gegenüber knapp 13.8 Minuten der ML-Luhmann-Mitglieder (Ergebnistabelle V4). Die Angaben verdanken sich allerdings einer in der Regel wenig zuverlässigen Selbsteinschätzung der Befragten. Bei der Bitte um eine Selbsteinschätzung wurde nicht verlangt, die Angaben auf einen bestimmten Zeitraum - etwa einen Tag - zu standardisieren, auch wenn nur wenige Male in der Woche hineingesehen wird. Diese Werte können deshalb nur einen ersten groben Eindruck davon vermitteln, in welchem Maße die Beteiligung an Mailinglists-Debatten das Zeitbudget belastet. Zur Klärung von Zeitbudget-Fragen muss zweifellos eine eigens zu konzipierende Rezeptionsforschung einsetzen. Immerhin ist dieser Unterschied zwischen beiden Mailinglists, bei einer Fehlerwahrscheinlichkeit von 5%, signifikant. Dass sich die Mitglieder der ML-Soziologie weniger Zeit nehmen, mag zum einen an der geringeren Anzahl der Beiträge liegen, insbesondere an den speziell auf Diskussionen zielenden, gehaltvollen Beiträgen zum Zeitpunkt der Befragung. Außerdem sind die befragten Mitglieder der ML-Soziologie mit 6.3 Mailinglists im Schnitt mit zwei zusätzlichen Mailinglists gegenüber denen der ML-Luhmann belastet (Ergebnistabelle V14).
6.1.8 Welche Bedeutung schreiben die Mitglieder den Mailinglist-Debatten zu?
Die Bedeutung von Mailinglists wird von den Befragten übereinstimmend, nämlich mit einem Anteil von Dreivierteln, als ein Beitrag zur Demokratisierung des wissenschaftlichen Diskurses eingeschätzt (S: 74.7% / L: 75.6%) (Ergebnistabelle V). Nicht ganz so einheitlich wird dagegen das Fehlen redaktioneller Filter in Mailinglists beurteilt: 83.3% der Befragten der ML-Soziologie beurteilen das Fehlen als eine Stärke der Mailinglist, die Befragten der ML-Luhmann dagegen zu 90.2% (Ergebnistabelle V46).
Fragt man nach einem differenzierteren Urteil zur Bedeutung von Mailinglists für den wissenschaftlichen Diskurs, kreuzten die Befragten zwar in beiden Mailinglists mehrheitlich die Antwortvorgabe an, dass Mailinglists interessant und wichtig seien und den Bestand an wissenschaftlichen Diskursmedien ergänzten, doch ist hier der Unterschied mit knapp 12% zwischen den Listen bemerkenswert (S: 42.9% / L: 54.8%) (Ergebnistabelle V52).
Dem radikalsten Statement zu dieser Frage, nämlich dass Mailinglists die etablierten Diskursmedien auf eine drastische Weise verändern werden, stimmten in der ML-Soziologie 14.1% und in der ML-Luhmann 20% zu. Allerdings zeigte sich die Mehrheit der Befragten nicht sonderlich interessiert an der bedenklichen Machtposition des Listowners, der ohne Ausweis seiner Kriterien und ohne Legitimation seitens der Mitglieder über die Mitgliedschaft von Interessenten an der Mailinglist entscheiden kann: In der ML-Soziologie gaben 10.1% der Befragten an, dass ihnen dies aufgestoßen sei, in der ML-Luhmann waren es 7.2% (Ergebnistabelle V47).
Dieses geringe Maß an Sensibilität gegenüber der politischen Struktur einer Mailinglist läßt sich als ein Hinweis für die relative Bedeutungslosigkeit der Liste in der Wahrnehmung ihrer Nutzer deuten. Der Umgang mit den Mailinglists als Diskursmedium ist insofern, obwohl Mailinglists überwiegend als ein demokratische Medium geschätzt werden, bis zu einem gewissen Grade unkritisch. Es wird vermutlich stillschweigend davon ausgegangen, dass der Owner sich auf Verwaltungsaufgaben beschränkt, die nicht die Entscheidung über Mitgliedschaft betreffen, und sich im Falle eines Konflikts mit dem Mailinglistowner problemlos eine Diskussion über seine Vorgehensweise führen läßt. Man leistet sich eine vordergründig unkritische Position, weil recht leicht Korrekturen möglich sind.
Um an ein weiteres Indiz für eine ernsthafte Beschäftigung mit den Möglichkeiten einer Mailinglist zu gelangen, wurde die Frage gestellt, ob die Hilfetexte des Servers bezogen wurden. Dies bejahten in der ML-Soziologie 21.6% der Befragten, in der ML-Luhmann 17.3% (Ergebnistabelle V48). Und 7.7% der Befragten der ML-Soziologie und 11.4% der Befragten der ML-Luhmann haben sich mindestens ein Mal einen der monatlich archivierten Texte aus dem Mailinglist-Archiv zuschicken lassen.(Endnote 9) (Ergebnistabelle V49). Auch diese beiden eher als gering zu bewertenden Anteile lassen sich als Hinweise darauf verstehen, welch eher geringe Bedeutung die Mailinglists für die meisten Mitglieder haben, obwohl das Niveau insbesondere der ML-Luhmann als hoch und das Kosten-Nutzenverhältnis als gut eingeschätzt wird.
Einen Hinweis darauf, dass es offenbar nur wenige Bemühungen gibt, spielerisch die neuen Möglichkeiten des neuen Mediums zu ergründen, zeigen die Ergebnisse auf die Frage, ob die Mitglieder schon einmal mit dem Gedanken gespielt (oder ihn umgesetzt) hätten, sich unter einem Pseudonym in die Mailinglist einzutragen, um selbst eine konträre Position zum eigenen Beitrag einnehmen zu können. Diese Frage bejahten in der ML-Soziologie 5.4% der Befragten, in der ML-Luhmann 6.5% (Ergebnistabelle V45). Nun, es gibt sicher keine Notwendigkeit, auf eine solche Idee zu verfallen und nicht jeder verfügt über die technische Möglichkeit, sich einen Pseudonym-Account einzurichten. Aber ich denken auch, dass gerade Soziologinnen und Soziologen mehr als anderen eine Umgebung auffallen könnte, in der ein kreativer Umgang mit verschiedenen Rollensets, also ein leichthändiges Identitätenmanagement, möglich ist.
6.1.9 Wie beurteilen die Mitglieder das Geschehen in den Mailinglists?
Befragt nach einem Urteil zum fachlichen Niveau der Beiträge, zeigt sich ein signifikanter Unterschied (5% Fehler-Wahrscheinlichkeit, z-Wert: 6.39) zwischen den Mailinglists. Faßt man die Urteile "sehr hohes Niveau" und "hohes Niveau" zusammen, so attestieren der ML-Soziologie 17.4% (sehr hoch: 2.4%) der Befragten ein hohes Niveau, in der ML-Luhmann sind es dagegen 69.9% (sehr hoch: 15.4%) (Ergebnistabelle V18).
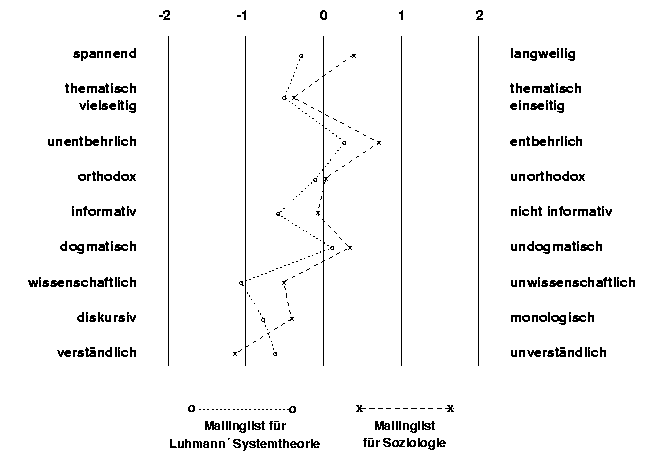
| Urteil | ML-SOZ, M/SD | ML-LUH, M/SD | z-Wert |
| spannend - langweilig | 0.3700 / 0.7548 | -0.2957 / 0.6766 | 8.21 |
| them. vielseitig - einseit. | -0.3941 / 0.8215 | -0.5563 / 1.1177 | 1.42 |
| unentbehrlich - entbehrl. | 0.7634 / 1.4467 | 0.2642 / 0.6027 | 4.08 |
| orthodox - unorthodox | 0.0255 / 0.2972 | -0.1314 / 0.4539 | 3.45 |
| informativ - nicht-inform. | -0.0706 / 0.4560 | -0.5775 / 1.1522 | 4.93 |
| dogmatisch - undogmat. | 0.3889 / 0.7703 | 0.1168 / 0.4664 | 3.76 |
| wissenschaftlich - unwiss. | -0.5059 / 1.0373 | -1.0633 / 2.0015 | 3.00 |
| diskursiv - monologisch | -0.3989 / 0.8353 | -0.7481 / 1.4625 | 2.50 |
| verständlich - unverständ. | -1.3309 / 2.1237 | -0.6223 / 1.2092 | 2.64 |
Um es genauer zu wissen, wurden verschiedene Statements zur Beurteilung der Beiträge angeboten.
Die Urteile der Befragten beider Listen weisen, mit Ausnahme des Urteils zur Langweiligkeit und zur Orthodoxie(Endnote 10) , jeweils in die gleiche Richtung: Beide Mailinglists werden bei Vorgabe von Gegensatzpaaren als thematisch eher vielseitig, als eher informativ, als eher undogmatisch, aber auch als eher entbehrlich beurteilt. Sie gelten darüberhinaus als eindeutig wissenschaftlich orientiert, diskursiv und verständlich. Die Urteile der ML-Luhmann weisen dabei allerdings, mit Ausnahme der Frage nach der Verständlichkeit, signifikant deutlich positivere Werte auf, insbesondere was die Entbehrlichkeit, die Informativität und Wissenschaftlichkeit der Beiträge angeht. Der bemerkenswerteste Unterschied in der Beurteilung beider Mailinglists besteht darin, dass die ML-Luhmann-Liste für eher spannend, die ML-Soziologie-Liste dagegen für eher langweilig befunden wird, was sich als eine Art Gesamturteil zur Attraktivität der Listen interpretieren liesse.
(Ergebnistabelle V19: spannend ... langweilig)
(Ergebnistabelle V20: thematisch vielseitig ... them. nicht viels.)
(Ergebnistabelle V21: unentbehrlich ... entbehrlich)
(Ergebnistabelle V22: orthodox ... unorthodox)
(Ergebnistabelle V23: informativ .... nicht informativ)
(Ergebnistabelle V24: dogmatisch ... undogmatisch)
(Ergebnistabelle V25: wissenschaftlich ... unwissenschaftlich)
(Ergebnistabelle V26: diskursiv ... monologisch)
(Ergebnistabelle V27: verständlich ... unverständlich)
Um die Urteile über die Mailinglists noch feiner nachzeichnen zu können, sollten die Mitglieder angeben, was sie an der ML-Soziologie bzw. an der ML-Luhmann am meisten schätzen und was sie am meisten stört.
| ML-Soziologie | ML-Luhmann | |
| Insgesamt beantwortete Fragebögen: | 173 | 143 |
| Antwortende | 129 (74.6%) | 118 (82.5%) |
| Angaben | 144 | 153 |
Nach Hauptkategorien getrennt, werden die folgenden Aspekte an den beiden Mailinglists besonders geschätzt:
| ML-Soz. | ML-Luh. | |
| Aspekte des konstitutiven Grundverständnisses der Liste: | ||
| a. Die Existenz der Liste | 9 | 4 |
| b. Die Begrenzung der Liste auf ein Theoriegebiet | - | 10 |
| c. Die Einrichtung einer Liste für das ganze Fach Soziologie | 4 | - |
| Aspekte des technisch-organisatorischen Bereichs der Liste: | ||
| a. Zugang und Beteiligung ohne Begrenzung durch Titel/ Stellung | 17 | 4 |
| b. Möglichkeit zum schnellen Kontakt mit Kollegen und Experten | 15 | 7 |
| c. Möglichkeit, das Geschehen einfach beobachten zu können. | 2 | 3 |
| d. Sonstige | 5 | 4 |
| Aspekte der List-Diskussionen: | ||
| a. die Diskussionsfreudigkeit der Liste | 1 | 7 |
| b. die Freundlichkeit im Umgang mit Diskussionsbeiträgen anderer | 2 | 4 |
| c. Konzentration der Diskussionen um Themenschwerpunkte | 1 | 4 |
| d. Der geringe Traffic | 3 | - |
| e. Sonstige | 1 | 2 |
| Aspekte des Bedeutungsgehalts von Beiträgen: | ||
| a. die Vielfalt der Themen in den Beiträgen | 11 | 15 |
| b. die Vielfalt der Meinungen in den Beiträgen | 4 | 5 |
| c. die niveauvollen/informationshaltigen Beiträge | 13 | 26 |
| d. die Literatur und Veranstaltungshinweise in den Beiträgen | 14 | 8 |
| e. Sonstige | 2 | 3 |
| Aspekte bilanzierter Rezeptionsergebnisse: | ||
| a. der erzielbare Überblick über Themen und Meinungen | 17 | 21 |
| b. die Anregungen und Denkanstöße | 6 | 19 |
| c. Sonstige | - | 1 |
| Nicht mittels dieses Schemas zu erfassen | 17 | 6 |
Es sind vor allem zwei Eigenschaften der Liste für Soziologie, die sich besonders häufig größter Wertschätzung erfreuen. Zum einen handelt es sich um die Demokratisierung der Zugangs- und Beteiligungsmöglichkeiten zu bzw. an einem fachspezifischen Forum, ohne Bindung an Bildungstitel und Positionen. Zum zweiten gelten die erreichten Zugewinne einer Vielfalt von Informationen und Hinweisen, sowie die eröffneten Kontaktgmöglichkeiten mit Fachkollegen als größte Stärke dieser Liste.
| 1. Zugangs- und Beteiligungsfreiheit ohne Beachtung von Titeln und Hierarchien | 17 (11.8%) |
| 1. Überblick über Themen und Meinungen | 17 (11.8%) |
| 3. Schneller und direkter Kontakt mit Kollegen und Experten | 15 (10.4%) |
| 4. Literatur und Veranstaltungshinweise | 14 (9.7%) |
| 5. Niveauvolle und informationshaltige Beiträge | 13 (9%) |
| 6. Themenvielfalt der Beiträge | 11 (7.6%) |
Besonders geschätzt werden in der Luhmann-Liste das Niveau und die innere Differenzierung der Auseinandersetzung mit der Systemtheorie, die als geeignet betrachtet wird, einen Überblick zu vermitteln und Anregungen und Denkanstöße zu geben. Hier muss allerdings hervorgehoben werden, dass allein acht Mal die Beiträge von Peter Fuchs gesondert genannt wurden.
| 1. Niveauvolle/ gehaltvolle Beiträge | 26 (17%) |
| 2. Überblick über Themen und Meinungen | 21 (14%) |
| 3. Anregungen und Denkanstöße | 19 (12.7%) |
| 4. Vielfalt der Themen der Beiträge | 12 (8%) |
| 5. Begrenzung der Liste auf ein Theoriegebiet | 10 (6.7%) |
Den besonders geschätzten Eigenschaften der beiden Mailinglists wird nun eine Liste störender Aspekte gegenüber gestellt.
Auf die Frage, was sie am meisten störe, haben geantwortet:
| ML-Soziologie | ML-Luhmann | |
| Insgesamt beantwortete Fragebögen: | 173 | 143 |
| Antwortende | 120 (69.3%) | 109 (76.2%) |
| Angaben | 145 | 128 |
Im einzelnen wurden die folgenden störenden Aspekte genannt, die wieder zu Hauptgruppen zusammengefaßt sind:
| ML-Soz | ML-Luh | |
| Antworten ohne Bezeichnung eines störenden Aspekts der Liste: | ||
| a. Bekundung nichts als besonders störend zu betrachten | 18 | 13 |
| b. Bekundung nicht zu wissen, was als besonders störend aufgefallen wäre | 6 | 1 |
| Aspekte aus dem technisch-organisatorischen Bereich: | ||
| a. Nutzung der Liste für den bilateralen Austausch von Mails | 4 | 4 |
| b. das Anhängen von Attachments/ Redundanzen | 10 | 6 |
| d. technische Probleme beim Lesen von Mails | 1 | 4 |
| c. Sonstige | 2 | 5 |
| Aspekte aus dem Bereich der Listendiskussion: | ||
| a. zu wenige Diskussionen/ länger andauernde Diskussionsthemen | 14 | 6 |
| b. Selbstdarstellungen und Unzulänglichkeiten im Diskussionsverhalten | 23 | 19 |
| c. geringer Traffic | 5 | 3 |
| d. Sonstige | 4 | 2 |
| Aspekte des Bedeutungsgehalts von Beiträgen: | ||
| a. die fehlende Behandlung bestimmter Themen | 10 | 5 |
| b. das hohe Aufkommen von Beiträgen mit geringem Niveau | 23 | 15 |
| c. das hohe Aufkommen an Literatur- und Veranstaltungshinweisen | 11 | 3 |
| d. Sonstige | 6 | 6 |
| e. die unkreative und unkritische Behandlung der Systemtheorie | - | 13 |
| f. unverständlich geschriebene Beiträge | - | 12 |
| Aspekte aus dem Bereich der Bilanzierung: | ||
| a. Der geringe Ertrag | 7 | 4 |
| b. Sonstiges | 1 | 0 |
| Ohne Zuordnung: | 8 | 7 |
Die genannten Aspekte machen deutlich, dass in beiden Listen vor allem die Nutzung der Liste zur Selbstdarstellung und die Nichteinhaltung von Diskussionsnormen als am meisten störende Erscheinung der Liste wahrgenommen werden. Besonders häufig werden auch solche Beiträge als größtes Störpotential der Liste genannt, denen ein geringer Informationsgehalt bzw. ein geringes Niveau attestiert wird. In der ML-Soziologie werden Beiträge mit dieser Zuschreibung allerdings deutlich häufiger genannt. Dies hängt sicherlich damit zusammen, dass in der ML-Soziologie derart taxierte Beiträge häufiger auftreten. Ein solches Urteil ist wenig überraschend. Und vermutlich ist es wenig mehr als das Echo der Orientierung an klassischen Publikationsmedien, gegen deren schlechte Beiträge man sich kaum wehren konnte, es sei denn, man kaufte fortan die Zeitschrift nicht mehr. In einer Mailinglist kann jedes Mitglied aktiv regulierend eingreifen, indem er gehaltvollere Diskussionen initiiert.
| 1. Selbstinszenierungen und andere Unzuläglichkeiten im Diskussionsverhalten | 23 (15.9%) |
| 1. Beiträge mit geringem Informationsgehalt/Niveau | 23 (15.9%) |
| 3. Wenig Diskussionen/ länger andauernde Diskussionsthemen | 14 (9.7%) |
| 4. Das Aufkommen an Literatur- und Veranstaltungshinweisen und Nachfragen | 11 (7.6%) |
| 5. Wenig interessante Themen bzw. Fehlen interessanter Themen | 10 (6.9%) |
| 1. Selbstinszenierungen und andere Unzulänglichkeiten im Diskussionsverhalten | 19 (14.8%) |
| 2. Beiträge mit geringem Informationsgehalt/ Niveau | 15 (11.8%) |
| 3. Unkreative und unkritische Behandlung der Systemtheorie | 13 (10.1%) |
| 4. Unverständlich geschriebene Beiträge | 12 (9.3%) |
| 5. Wenig Diskussionen oder länger andauernde Diskussionsthemen | 6 (4.7%) |
Der Befund, dass in der ML-Luhmann intensive Debatten stattfinden, wird durch eine Ende März 1999, von Moses A. Boudourides, Andres G. Zelman und Apostolis Salkintzis veröffentliche Studie bestätigt, in der mehrere offen zugängliche Mailinglists, darunter auch die ML-Luhmann, quantitativ vermessen wurden.(Endnote 11)
Die ML-Luhmann sticht im Vergleich zu den anderen Listen in einigen Aspekten heraus: Die tägliche Belastung durch Artikel fällt mit 0.58 Beiträgen pro Tag(Endnote 12) im Vergleich am geringsten aus, der Partizipationsfaktor mit 77.46% ist dagegen der zweithöchste, der Anteil an verketteten, aufeinander Bezug nehmenden Mails ("Threaded Mails") ist mit 76.69% der höchste unter den untersuchten Mailinglists. Ich interpretiere diese Faktoren als akzeptable Operationalisierungen für den Aspekt der Intensität der Debatten. Darüberhinaus geben die Autoren dieser Studie einen interessanten Faktor an. Sie haben speziell für threaded mails eine Thementypologie erstellt und geben für die ML-Luhmann eine Verteilung von Themen an.
| Thread-Themen | Announce. | Administr. | Theory | Query | Maintenance | Miscell. |
| ML-Luhmann | 3.65% | 0% | 58.9% | 30.59% | 3.65% | 3.32% |
Interessant an dieser Themenverteilung ist insbesondere der Anteil an Threaded-Mails zu adminstrativen Themen von 0% und Maintenance mit 3.65%. Offenbar besteht kein Bedarf an Metadiskussionen zur Mailinglist selbst. Es bedarf, etwas anders gewendet, offenbar keiner Beiträge, anhand derer sich die normativen Erwartungen an die Mailinglist regulieren. Womöglich läßt sich dieser Wert auch als Zufriedenheit mit der Arbeit des Listowners interpretieren.
In welchem Maße beteiligen sich die Teilnehmer aus diesen Gruppen nun aktiv an Diskussionen? Im einleitenden Kapitel über "wissenschaftlichen Diskurs und Mailinglists" war davon die Rede, dass es allenfalls für den akademischen Mittelbau naheliegen könnte, sich bei Diskussionen zurückzuhalten, weil sie am ehesten unter dem Eindruck stehen könnten, mehr zu geben als zu nehmen. Zugleich ist es der Mittelbau, der von Mailinglists als Thesentest- und Thesengeneriermaschinen am meisten profitiert.
6.2 Die Autoren
Als einen Autoren bezeichne ich dasjenige Mitglied einer Mailinglist, das auf der Liste in Erscheinung tritt, gleichgültig ob mit einem gehaltvollen Diskussionbeitrag oder mit einer schlichten Frage nach Literatur oder einem Hinweis auf eine Publikation. In nachfolgenden Studien wäre es sicher sinnvoll, die Bezeichnung "Autor" denjenigen vorzubehalten, die nachhaltig an Diskussionen teilnehmen und ansonsten, so wie es im Rest dieser Studie der Fall ist, von Teilnehmern zu sprechen.(Endnote 13)
| ML-Soziologie | ML-Luhmann | ML-IMD | |
| 19.01.1995 - 01.01.99 | 20.11.95 - 01.01.99 | 01.02.95 - 31.12.98 | |
| Autoren insgesamt | 386 (336 bereinigt) | 317 (272 bereinigt) | 232 (210 bereinigt) |
| Anteil an Autorinnen | 14.7% (unbereinigt) | 9.3% (ub) | 10% (ub) |
| Verhältnis Mitgl./Autor (monatl.) | 6.3% (ub) | 7.8% (ub) | 7.5% (ub) |
| Mitglied war mindest. 1 x Autor | 38.1% (ub) | 40.3% (ub) | - |
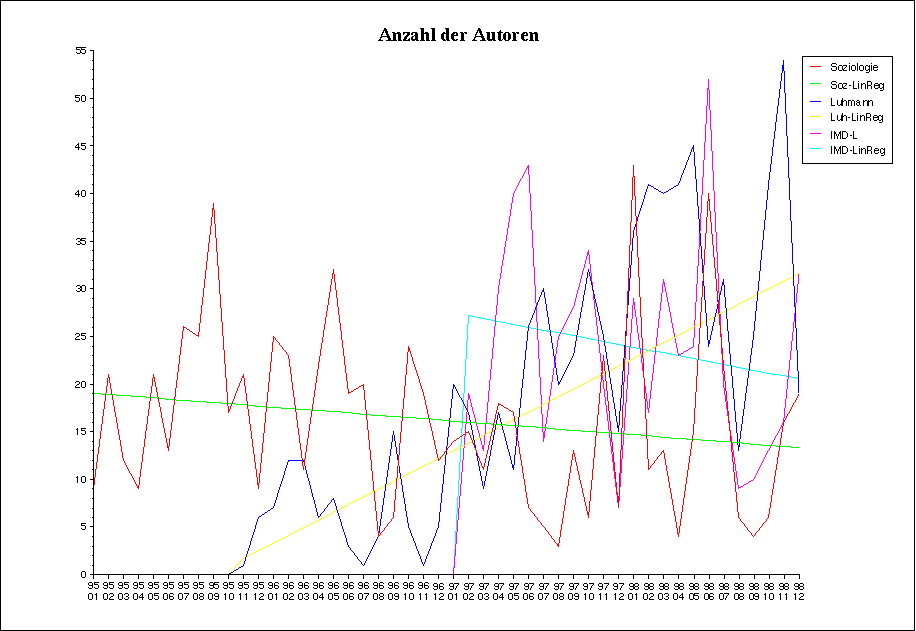
Im monatlichen Durchschnitt schreiben, über die ganze Zeit aggregiert, in der ML-Soziologie 16, in der ML-Luhmann 19 und in der ML-IMD 24 verschiedene Autoren. Die absolute Zahl der Autoren in der ML-Soziologie und in der ML-IMD nimmt tendentiell leicht ab, während sie in der ML-Luhmann dagegen stark zunimmt. In der ML-Soziologie und in der ML-IMD verschlechtert sich zudem das Verhältnis zwischen den aktiven Schreibern und den Lesenden kontinuierlich. So startete die ML-Soziologie in den ersten Wochen mit einem Anteil von 77% schreibender Mitglieder und schwankte im Laufe des ersten halben Jahres zwischen 13% und 22%, um im Jahr 1998 dann auf durchschnittlich 3.3% abzusacken. Auch hier macht die ML-Luhmann eine Ausnahme: Hier nahm sogar der Anteil der Schreibenden tendentiell leicht zu und betrug im Jahr 1998 9.3%.
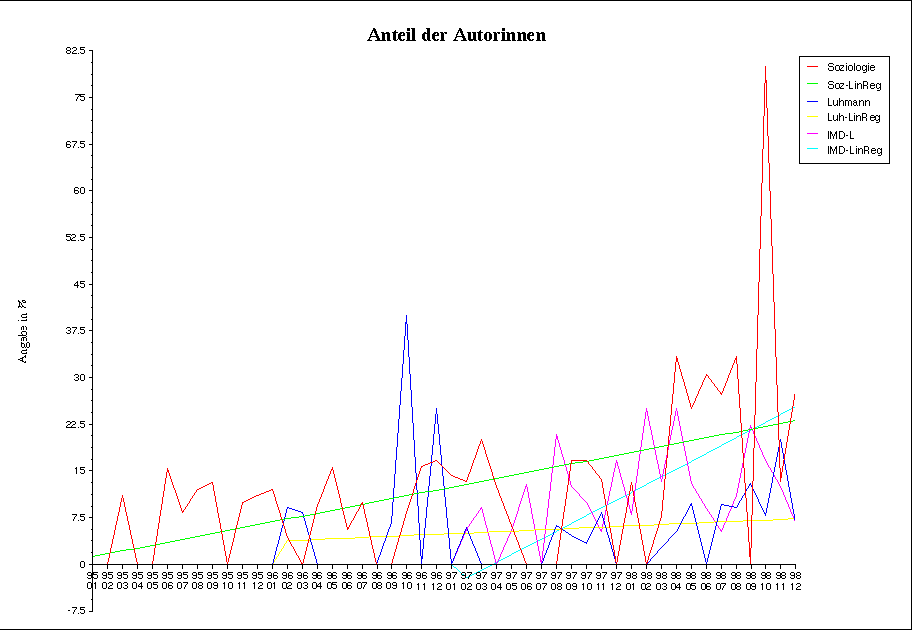
Der Anteil der Autorinnen nimmt in allen drei Listen tendentiell zu, am schwächsten allerdings auf dem ohnehin geringen Niveau in der ML-Luhmann. Der extreme Ausreißer von 80%-Frauenanteil in der ML-Soziologie im Oktober 1998 kam deshalb zustande, weil in diesem Monat nur wenige Artikel erschienen. Gleiches gilt für den Ausreißer in der ML-Luhmann im Oktober 1996.
6.2.1 Wie viele Autoren bestreiten den Hauptanteil des Beitragaufkommens?
| ML-Soziologie | ML-Luhmann | ML-IMD | |
| 19.01.1995-31.12.1998 | 20.11.1995-31.12.1998 | 01.02.1997-31.12.1998 | |
| Top-5 der Autoren | 25.8% Textanteil | 36% Textanteil | 36.1% Textanteil |
| Top-10 der Autoren | 35.8% Textanteil | 51% Textanteil | 49% Textanteil |
| Top-30 der Autoren | 54.5% Textanteil | 79.5% Textanteil | 77.9% Textanteil |
| 25%-Textanteil | 5 Autoren | 3 Autoren | 3 Autoren |
| 50%-Textanteil | 24 Autoren | 10 Autoren | 10 Autoren |
| 1. Frau an | 8. Position | 49. Position | 1. (und 3.) Position |
In der ML-Luhmann bestreiten drei Autoren 25% des gesamten Artikelaufkommens. In der ML-Soziologie sind es für den gleichen Artikelanteil immerhin fünf Autoren. In der ML-Luhmann decken 30 Autoren knapp 80% des gesamten Artikelaufkommens ab. Diese Zahlen wurden anhand einer Aggregation über den gesamten Zeitraum seit Bestehen der Listen ermittelt. Die auffällig geringe Frauenpräsenz in der ML-Luhmann wird noch mal unterstrichen dadurch, dass die erste Frau an der 49. Position des Artikelaufkommens steht.
In der ML-Luhmann dominiert ein Autor ganz eindeutig. Von den insgesamt 1689 Beiträgen entfallen allein auf diesen 9.5% der Beiträge. Eine starke Dominanz der Kommunikation durch wenige Autorinnen und Autoren läßt sich immer dann beobachten, wenn zwei Autoren oder zwei Lager im Streit aneinandergeraten und dabei die Contenance verlieren und beispielsweise über Motive der anderen Seite spekulieren. Dies ist in der ML-Luhmann und in der ML-IMD deutlich jeweils einmal so eskalierend der Fall gewesen, dass sowohl die Autorin mit den meisten Artikeln der gesamten ML-IMD als auch der Autor auf der 3. Position der ML-Luhmann die Mailinglists jeweils verliessen.(Endnote 14)
Unter den zehn erstplazierten Autoren der Listen gibt es keine namentlichen Überschneidungen zwischen der ML-Soziologie und ML-Luhmann. Und unter den ersten 30 sind es drei Autoren, die in beiden Listen in Erscheinung traten.
In der ML-Soziologie haben 32.2%, in der ML-Luhmann 42.3% der Befragten angegeben, bereits einen Artikel auf der Mailinglist publiziert zu haben (Ergebnistabelle V31). Hiernach lässt sich feststellen, dass Befragte, die aktiv als Autoren in Erscheinung treten, auch überproportional häufig den Fragebogen beantwortet haben.
Ferner interessierten die Motive, die Mitglieder davon abhalten, Beiträge zu veröffentlichen. Hier ergab sich zwischen den Listen ein auffallend unheitlicher Befund.
Die meisten Befragten gaben an, dass ihnen bislang vor allem ein Anlaß gefehlt habe, um selbst mit einem Beitrag aufzuwarten (S: 91.2% / L: 72.9%) (Ergebnistabelle V39). Dieses deutliche Statement begreife ich als Indiz dafür, dass von einem Großteil der Mitglieder offenbar nicht realisiert wird, dass es keines Abwartens von Gelegenheiten bedarf, weil in Mailinglists Anlässe schlicht durch Aktivität frei geschöpft werden können. Ich vermute eher, dass gar kein so drängender Diskussionsbedarf vorliegt. Es fällt hier der Unterschied zwischen beiden Listen mit 18.3% auf. Fragt sich, ob dieser daher rührt, dass in der ML-Luhmann die Themen breiter streuen und insofern mehr Anlässe zur Verfügung stehen oder ob deren Mitglieder das Medium aktiver handhaben und bewußter wahrnehmen, indem sie initiativ werden.
Womöglich erklärt diese klassisch-abwartende Haltung auch den eher geringen Grad der Verbundenheit und Verantwortung der Mitglieder dem Medium gegenüber. In der ML-Soziologie bejaten 26.8% und in der ML-Luhmann 34.5% der Befragten (Ergebnistabelle V53), eine gewisse Verantwortung dafür zu verspüren, dass die Kommunikation mittels der Mailinglist gelingt.
Mangelnde Interessantheit der Beiträge ist jedenfalls überwiegend kein Hindernisgrund für eigene Aktivitäten (S: 26.6% / L: 11.6%) (Ergebnistabelle V35). Und ein hohes Niveau der Beiträge hält in der ML-Soziologie 4.4% der Befragten von einer Publikation eines eigenen Beitrags ab, in der ML-Luhmann sind es dagegen 22.1% (Ergebnistabelle V36).
36% der Befragten der ML-Soziologie und 59.5% der ML-Luhmann ist das Anfertigen eines Beitrags zu zeitaufwändig (Ergebnistabelle V37). Trotzdem wird das Aufwand-Nutzenverhältnis überwiegend als positiv eingestuft: In der ML-Soziologie halten dieses Verhältnis 77.7% der Befragten für gut, in der ML-Luhmann 82.7% (Ergebnistabelle V40).
Bei den Befragten einheitlich über beide Listen hinweg ist demgegenüber das Motiv ausgeprägt, das List-Geschehen nur beobachten zu wollen (S: 62.8% / L: 64.7%) (Ergebnistabelle V38).
6.3 Die Artikel
Nachfolgend sollen Fragen der folgenden Art interessieren: Wie viele Beiträge werden im Schnitt pro Monat/ Tag über die Mailinglist verteilt? Wie umfangreich sind die Beiträge und welche Themen werden überwiegend angesprochen?
- 6.3.1 Wie viele Beiträge wurden über die Mailinglists verteilt?
- 6.3.2 Welchen Umfang haben die Beiträge?
- 6.3.3 Die Themenschwerpunkte der Listen
- 6.3.4 Threads
6.3.1 Wie viele Beiträge wurden über die Mailinglists verteilt?
| ML-Soziologie | ML-Luhmann | ML-IMD | |
| 19.01.1995 - 31.12.1998 | 20.11.1995 - 31.12.1998 | 01.02.1997 - 31.12.1998 | |
| Artikel insgesamt | 1332 | 1689 | 1428 |
| Artikel pro Monat | 28.16 | 45.28 | 62.09 |
| Artikel pro Tag | 0.92 | 1.49 | 2.04 |
| Artikel pro Arbeitstag | 1.24 | 2.0 | 2.74 |
| Davon Re: im Subject | 52.10% | 55.83% | 57.35% |
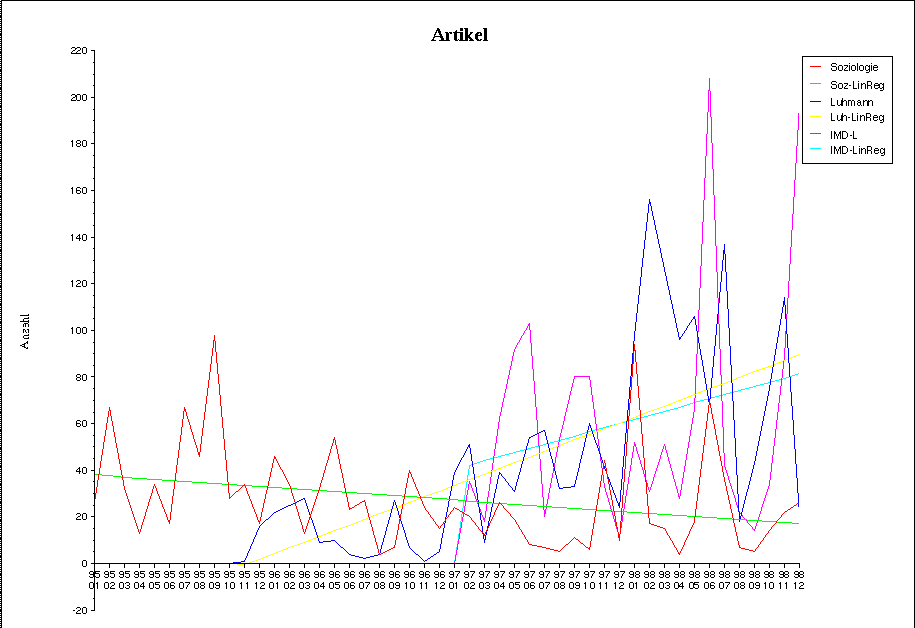
Die Anzahl der Beiträge pro Monat/ Tag schwankt stark, es gibt keinen gleichmäßigen Strom, nicht einmal eine annähernd verläßliche Grundversorgung mit einer erwartbaren Mindestanzahl an Beiträgen pro Zeiteinheit. Regelmäßigkeiten in den Schwankungen sind dabei ebensowenig auszumachen, abgesehen von der Verringerung der Zahl an Beiträgen im August. Auffallend ferner: Schon rund ein Jahr nach ihrer Gründung nahm die Zahl der Beiträge in der ML-Soziologie tendentiell wieder ab, während sie in der ML-Luhmann sowie der ML-IMD dagegen recht stark zunahm und zunimmt.
Die hier vorgelegten Daten zeichnen noch kein vollständiges Bild davon, welches Ausmaß an Kommunikationen per E-Mail durch die Mailinglist angestossen wird. Neben den öffentlichen Beiträgen gibt es auch eine Anzahl an nicht-öffentlichen bidirektionalen Mails, die durch diese öffentlichen Beiträge initiiert werden. Auch hier zeigte sich, dass die Kommunikationsdichte in der ML-Luhmann größer ist als die der ML-Soziologie: Auf einen öffentlichen Beitrag werden, laut Angaben der Befragten, in der ML-Soziologie durchschnittlich 2.5 weitere Mails verschickt und 3 weitere Mails empfangen, in der ML-Luhmann werden dagegen 5.3 weitere, nicht-öffentliche Mails verschickt und 5 weitere Mails zusätzlich empfangen (Ergebnistabelle V32).
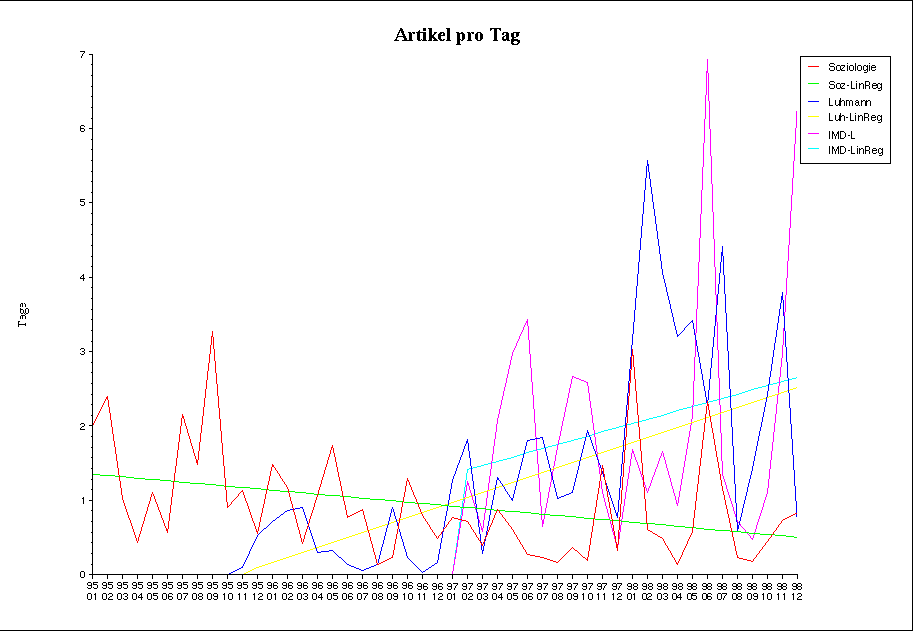
Es liegt angesichts dieser Zahlen die Vermutung nahe, dass die Unterschiede im Zuwachs der Zahl an Beiträgen in den Mailinglists ML-Soziologie und ML-Luhmann mit den unterschiedlichen Urteilen über das "Niveau", die "Langweiligkeit" oder die "Entbehrlichkeit" der beiden Mailinglists zusammenhängt (Urteile zu Mailinglist). Es stellt sich dabei die Frage, welche Kausalität unterstellt wird: Werden deshalb relativ wenige Beiträge für die ML-Soziologie angefertigt, weil das Niveau der Diskussionsbeiträge als niedrig und sie ansonsten als eher langweilig und ziemlich entbehrlich wahrgenommen wird, oder gilt der Zusammenhang umgekehrt: Weil so wenige Beiträge erscheinen, gilt sie als wenig niveauvoll und langweilig? Hier darf man wohl einen mitkoppelnden Zusammenahng vermuten.
Das Maximum an Beiträgen über einen mehrmonatigen Zeitraum findet sich in der ML-Luhmann, in der zwischen 9801 bis 9807 durchschnittlich 112.4 Artikel im Monat bzw. 3.7 Artikel am Tag eintrafen. In der ML-Soziologie finden sich zwei starke Ausreißer mit monatlich 98 (9509) und 94 (9801) Artikeln, in der ML-Luhmann drei Ausreißer mit 156 (9802), 126 (9803) und 137 (9807) Artikeln pro Monat, in der IMD zwei Ausreißer mit 208 (9806) und 197 (9812) Artikeln.
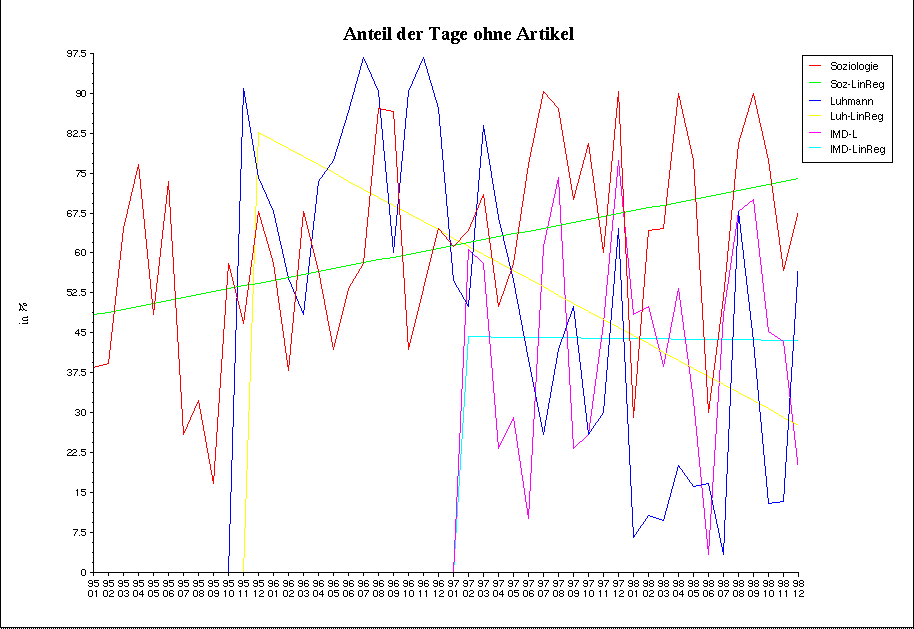
Der Soziologie-Ausreißer vom September 1995 ergab sich aufgrund von Beiträgen, in denen die meisten sich der Frage nach den Aufgaben eines Mailinglist-Koordinators, nach einer Definition, was Soziologie sei oder Soziologen tun, und einer Diskussion über Systemtheorie zuwandten. Die Subjects des Ausreißers vom Januar 1998 bezeichneten zu einem großen Anteil "Autopoiesis", "Raum" und "Zeit", häufig miteinander verbunden. Daneben gab es einen weiteren starken Thread, in dem es darum ging, ob fortan in der Subject-Zeile der Beiträge vom Mailinglist-Server automatisch ein SOZIOLOGIE ergänzt werden solle oder nicht. Die Ausreißer auf der Luhmann-Liste sind eigentlich nur Spitzen eines ohnehin hohen Artikel-Aufkommens im Zeitraum zwischen 9801 und 9807 auf einem inhaltlich sehr gutem Niveau, das insbesondere durch das Engagement eines bekannten Systemtheoretikers zustandekam (Peter Fuchs). Dann verringerte sich schlagartig das Artikelaufkommen, was womöglich mit dem krankheitsbedingten Fernbleiben Peter Fuchs in diesem Zeitraum zusammenhängt. Der IMD-Ausreißer im Juni 1998 fiel zusammen mit den Vorbereitungen für einen Kongress, den die IMD-Träger in Frankfurt veranstalteten; der Ausreißer im Dezember 1998 betraf vornehmlich das kommunikative Fehlverhalten eines Mailinglist-Mitglieds, das letztlich zum Ausschluß von der Liste führte. Der Ausschluß führte zu weiteren Diskussionen bezüglich der angemessenen Organisationsform der Mailinglist. Man kann generell sagen, dass das Artikelaufkommen immer dann hochschnellt, wenn es zu Metadiskussionen kommt, die die Organisation, das angemessene Verhalten der Autoren der Liste oder programmatische Ausrichtungen des Forums betreffen.
Die enormen Schwankungen der Artikelzahl liegen vermutlich daran, dass eine Liste nur beschränkt die Bearbeitung von mehreren Themen gleichzeitig verträgt. Es ist nur selten der Fall, dass innerhalb eines Zeitraums mehr als drei unabhängige Threads parallel laufen, von knappen Zwischenfragen und Antworten abgesehen. Wenn keine Beiträge zu einem Thema mehr folgen, ist schlicht solange Ruhe, bis wieder ein neues Thema angestoßen wird.
6.3.2 Welchen Umfang haben die Beiträge?
| ML-Soziologie | ML-Luhmann | ML-IMD | |
| 19.01.1995 - 31.12.98 | 20.11.95 - 31.12.98 | 01.02.97 - 31.12.98 | |
| Textumfang insgesamt: | 2.932MB | 4.073MB | 3.895MB |
| Textumfang pro Monat: | 62KB | 109KB | 169KB |
| Quote-Anteil: | 21.72% | 16.78% | 15.67% |
| HTML-Anteil: | 0.22% | 0.72% | 0.60 % |
| durchschittl. Umfang eines Art.: | 2248Bytes | 2301B | 2700B |
| Standardabweichung: | 3964Bytes | 2790B | 4236B |
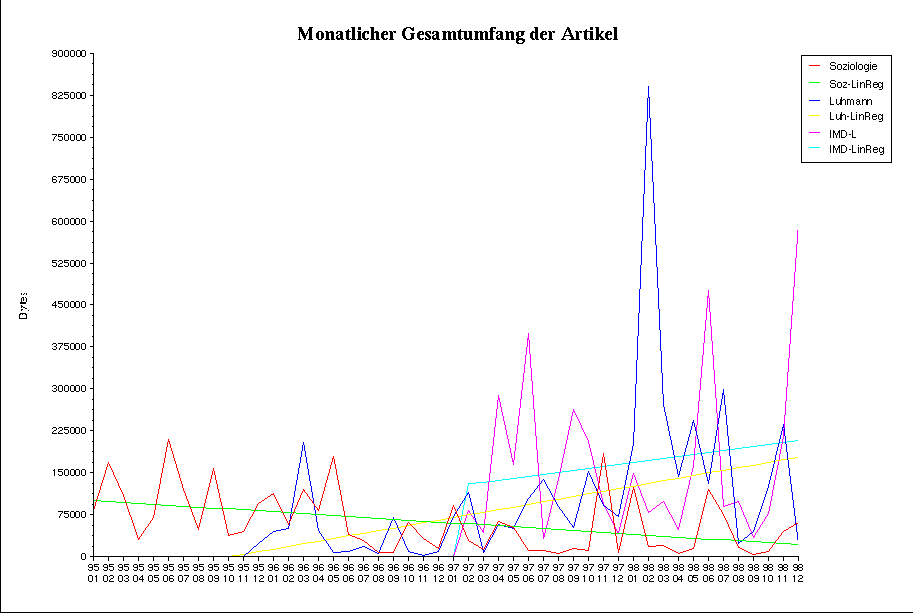
Parallel zur Anzahl der monatlichen Artikel schwankt auch der Umfang des monatlichen Textaufkommens beträchtlich.
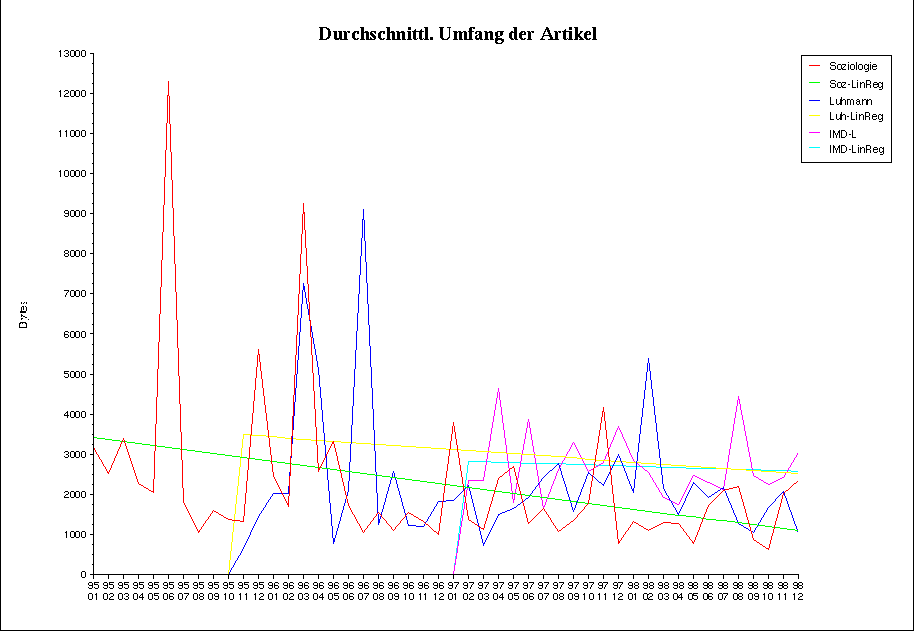
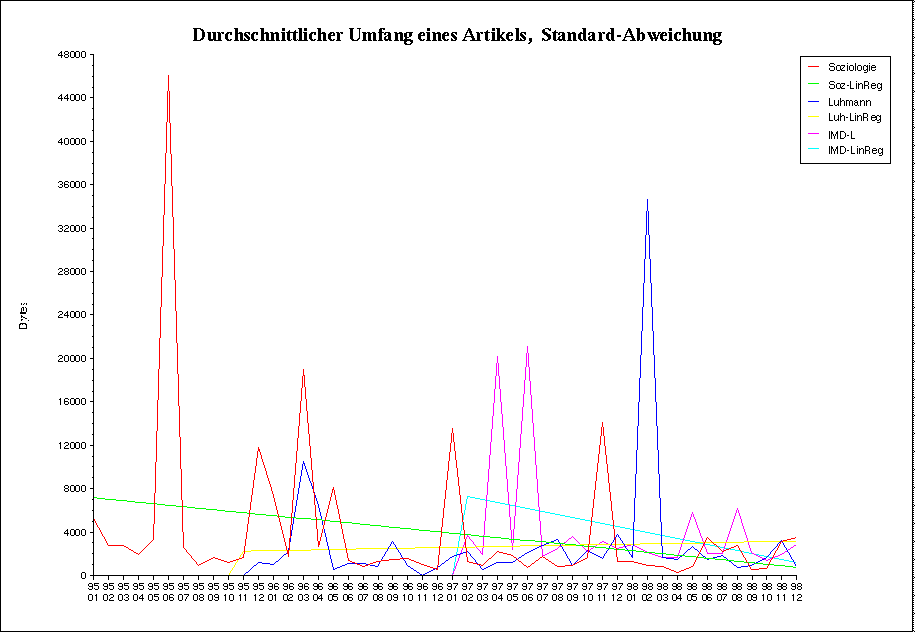
In allen drei Listen nimmt der Umfang der Beiträge tendentiell ab. Ebenso nimmt die Standardabweichung des Artikelumfangs in der ML-Soziologie und ML-IMD ab, während sie in der ML-Luhmann unverändert bleibt. Beide Faktoren liessen sich als Hinweis dafür interpretieren, dass sich über die Zeit eine Auffassung über die dem Medium angemessene Textlänge herausgebildet hat bzw. herausbildet. Zu Beginn der Nutzung einer frisch gegründeten Mailinglist herrschte noch eine relativ große Unsicherheit darüber, welche Textform angemessen wäre. So findet man hier eine Menge an relativ umfangreichen Texten, die eher klassisch erörternd-ausgewogen und weniger auf diskursive Anschlüsse angelegt waren. Es kam zu Anfang vor, dass jemand eine umfangreiche WinWord-Textdatei einer abgeschlossenen und bereits veröffentlichten Publikation über die Mailinglist verteilte, die Liste also als einen kostengünstigen Vertriebsweg und nicht als Forum für Diskussionen nutzte.(Endnote 15)
Betrachtet man anhand des Quote-Anteils die Entwicklung im Hinblick darauf, ob mehr oder weniger zitiert wird, so zeigt sich, dass dieser Anteil auf unterschiedlichen Niveaus stabil bleibt und nur ganz leicht konvergiert. In der ML-Soziologie liegt dieser Anteil am höchsten bei 20%. Nimmt man den Anteil der Re: als einen weiteren Indikator für das Maß der Verschränkung von Artikeln, dann nimmt die Zahl der auf diese Weise bezugnehmenden Artikel einzig in der ML-Luhmann zu, in den beiden anderen Liste dagegen ab.
Dies ist insofern überraschend, da sich die Diskussionsbeiträge dieser Liste auf einem beständig hohen Niveau bewegten und verläßlich auf einem hohen Niveau kommentiert wurden. Womöglich darf man daraus die These ableiten, dass das Betreuen einer Liste auf inhaltlich hohem Niveau neue Mitglieder nicht etwa vom Schreiben eigener Beiträge abschreckt, sondern sie im Gegenteil motiviert und ermutigt.
6.3.3 Die Themenschwerpunkte der Listen
Die Themen der Beiträge der ML-Soziologie und der ML-Luhmann wurden grob nach primär diskursträchtigen Beiträgen und primär faktenorientierten, nicht-diskursträchtigen Mitteilungen unterschieden. In einer früheren Studie, in der ich einen ersten Überblick zu den Themen der ML-Soziologie gab, verwendete ich noch die folgenden Kategorien:
| Themen der Beiträge | Anteil (%) |
| Computer- und netzferne Themen rund um Soziologie (allgem. Situation, Theorie etc.): | 29.0 |
| Dank, expressive Stellungnahmen, Vorstellungen, Korrekturen, Suche nach Mitstreitern: | 15.0 |
| Mailinglist-Verwaltung, Kommentare zur Mailinglist: | 14.4 |
| Ausweiten der elektronischen Aktivitäten, Soziologie und Internet: | 13.6 |
| Hinweise auf Netzressourcen, Foren, Umfragen, Veranstaltungen, Publikationen | 11.4 |
| Zusammenhang Computernetze und Gesellschaft: | 8.0 |
| Computereinsatz (z.B. Literaturverwaltung, Arbeitsorganisation, Statistik): | 5.1 |
| Fragen nach Literatur, Netzressourcen: | 3.1 |
| Verschiedenes (z.B. fehlgeleitete Mails): | 0.4 |
In der nun vorliegenden Studie wurden die Themen der Mailinglists anhand von sechs Kategorien kodifiziert und dann die Themenverteilung ermittelt.(Endnote 16)
| Themen der Beiträge | Codes |
| Beiträge zur Theorie, zu Methoden und Geschichte der Soziologie bzw. Systemtheorie | A |
| Beiträge, die diese Mailinglist oder Mailinglists allgemein thematisieren. | B |
| Vorstellungen, Fragen zu Autoren und Liter., Dank, Hinw. auf Veranst., Publik., Umfragen | C |
| Organisatorische Hinweise der Mailinglistverwaltung | D |
| Fehlgeleitete Mails | E |
| Mit diesem Schema nicht zu Erfassendes | F |
Der Unterschied zwischen den beiden Liste ist deutlich: ML-Soziologie fungiert primär als eine Art Service-Liste für das "Tagesgeschäft", in der Mitteilungen von diskursiv eher trivialen Fakten (Ankündigungen von Seminaren, Konferenzen und Publikationen, Anfragen nach Literatur oder nach Mitstreitern mit ähnlich gelagerten Interessen und dergleichen mehr) im Vordergrund stehen. Die ML-Luhmann wird dagegen primär als Diskursliste mit vorwiegend theorieorientierten Argumenten, Fragen und Beobachtungen genutzt, auch wenn durchaus auf spezielle Veranstaltungen oder neue Publikationen hingewiesen wird.
| Codierung | ML-Soz: Anteil der Themen | ML-Luh: Anteil der Themen |
| A | 22% | 58% |
| B | 9% | 4% |
| C | 58% | 32% |
| D | 5% | 3% |
| E | 0% | 0% |
| F | 5% | 3% |
Im ersten Jahr des gemeinsamen Bestehens beider Listen zeigten sich thematisch weniger konturierte Unterschiede, die jeweiligen Anteile lagen sehr viel näher beisammen.(Endnote 17) Ab September 1996 zeichnete sich dann in der ML-Luhmann insgesamt ein Umschwung zu eindeutig vorwiegend inhaltlich-diskursiv angelegten Beiträgen ab, während in der ML-Soziologie solcher Art inhaltlicher Beiträge einen stetig geringeren Anteil einnahmen bzw. einnehmen. Auf die möglichen Gründe der unterschiedlichen Entwicklungen komme ich gleich zu sprechen.
Die verwaltungstechnischen Beiträge - hier handelt es sich überwiegend um Meldungen, in denen Mailadressen aus dem Mitgliederverzeichnis aufgelistet werden, die gelöscht wurden, weil diese Adressen über einen längeren Zeitraum nicht erreichbar waren und deshalb insbesondere bei den Autoren von Artikeln Fehlermeldungen erzeugten(Endnote 18) - pendeln sich offenbar auf ein Niveau zwischen 3% und 5% ein, wobei dieser Anteil in der ML-Soziologie zunächst größer ausfiel, während er in der ML-Luhmann konstant blieb. Dies mag u.a. daran liegen, dass die ML-Soziologie zehn Monate älter ist als die ML-Luhmann und somit für die Verwaltung der ML-Luhmann auf erste Erfahrungen anhand der ML-Soziologie zurückgegriffen werden konnte. Verwaltungstechnische Beiträge mit geringem Nutzwert und in kleinen Anteilen sind, auch wenn keine thematischen Fakten mitgeteilt oder diskurswürdige Themen angeboten werden, insofern zur Reproduktion der Mailinglist funktional, weil sie anzeigen, dass der Kanal offen ist und dieses Medium funktioniert.
Die Beiträge, die sich mit der Ausgestaltung von Mailinglists im allgemeinen bzw. mit der konkreten Mailinglist als Thema befassen, nehmen insgesamt gesehen mit 9% bzw. 4% zwar einen geringen Anteil ein, branden aber stetig und dann heftig mit durchaus großem Anteil auf. Wenn man die Listen unter den Aspekten von viel Service und wenig Fachdiskurs (ML-Soziologie) oder unter den Aspekten viel Fachdiskurs und wenig Service (ML-Luhmann) beobachtet, mag man diesen Anteil der Selbstthematisierung als hoch bewerten, insbesondere wenn man die verwaltungstechnischen Anteile mit weiteren rund 5% hinzurechnet. Dies ist auf der anderen Seite jedoch dann nicht zwingend als zu hoch zu bewerten, wenn man berücksichtigt, dass die Implementierung dieses Mediums innerhalb des allgemeinen wissenschaftlichen Diskurses als nicht abgeschlossen gilt. Die Mitglieder können noch immer nicht abschliessend wissen, was sie von diesem Medium erwarten dürfen - die Spannweite der Beurteilung des Mediums Mailinglist durch die Befragten reicht von "drastische Veränderung des wissenschaftlichen Diskurses" bis hin zum "belanglosen Plauderkreis" (vgl. Fragebogen - V52). Weil die Themen "Mailinglists" oder "neue wissenschaftliche Kommunikationsformen" soziologisch umstandslos zugänglich sind, erscheint es mir nicht angemessen, diesen Anteil vollständig als letztlich unerwünschten Verwaltungsoverhead oder als wirkungsgradverringerndes, dynamikverschlechterndes hohes Grundrauschen zu bewerten. Die Frage der (Selbst-)Organisation des wissenschaftlichen Diskurses im besonderen bzw. der Technisierung der Kommunikationen im allgemeinen sind derzeit generell herausragende Themen.
Die folgenden beiden Grafiken veranschaulichen die angesprochenen Entwicklungen im zeitlichen Verlauf:
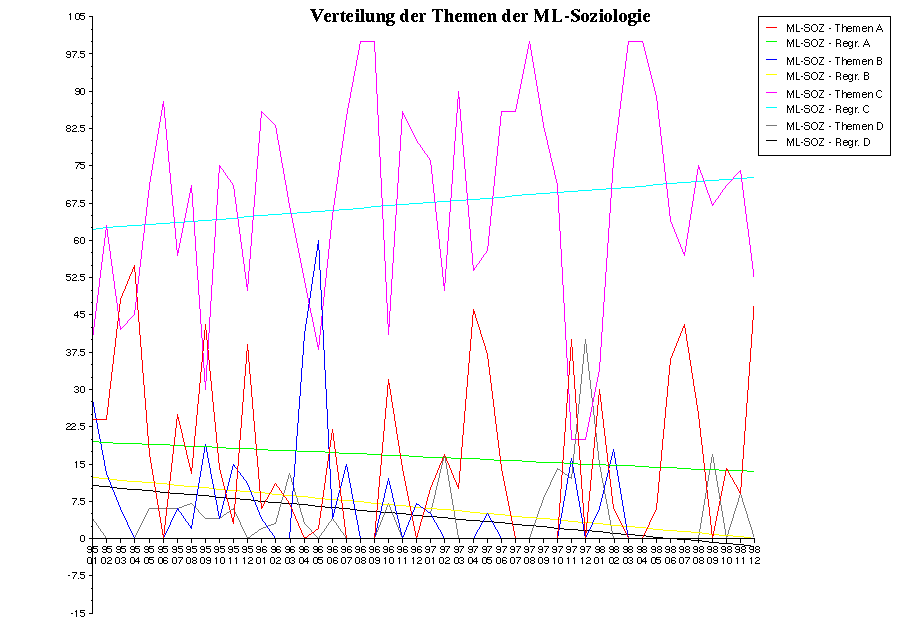
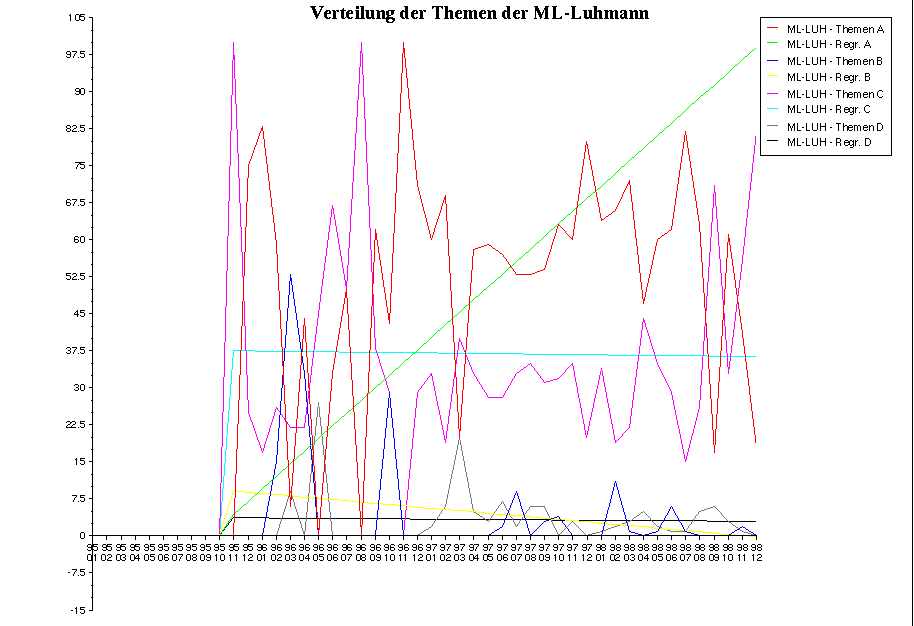
Woran könnte es liegen, dass die beiden Mailinglist so grundverschieden ausgerichtet sind? Warum werden in der ML-Soziologie vergleichsweise so wenige Fachdiskurse geführt?
Es lassen sich verschiedene Gründe anführen. So mag die ML-Soziologie thematisch zu offen angelegt sein und deshalb, im Vergleich zu einer von vornherein eher theoriegeleiteten Mailinglist wie die ML-Luhmann oder einer eher an Befragungstechniken orientieren Mailinglist wie die GIR-L einen zu gering konturierten Halt bieten. Die ML-Soziologie hat mit anderen Worten offenbar kein Thema. Generell scheinen Soziologen zudem rein fachintern zum Ende des Jahrhunderts keinen Diskursbedarf (mehr) zu haben oder es mangelt ihnen am Mut zur gehaltvoll kontroversen Debatte. Dass darüberhinaus der in Aussicht gestellte Gewinn einer Teilnahme an Mailinglist-Debatten nicht klar abzuschätzen ist, wird bereits im vorderen Teil dieser Studie diskutiert. Womöglich strahlen zudem schlechte Beiträge so stark und so lang anhaltend aus, dass das Medium für komplexere Gemüter regelrecht unbrauchbar wird, insbesondere wenn auf gehaltvolle Beiträge, die insbesondere Neulinge mitteilungsfreudig-hoffnungsfroh in die Liste setzen, keine darauf bezugnehmenden Beiträge folgen.
Andererseits... die ML-Luhmann wird erfolgreich für den soziologischen Diskurs in Anspruch genommen. Das Leitthema dieser Liste ist allerdings enger geschnitten und man muss vermuten, dass die Mitglieder von vornherein höher zur Teilnahme motiviert sind. Deutsche Mitglieder konnten nämlich zumindest bis Mitte der 90er Jahre noch der Ansicht sein, dass die Beschäftigung mit der Luhmannschen Systemtheorie eines der letzten mentalen Abenteuer (nicht nur) der Soziologie gelten kann, gerade weil sie zumeist vollkommen unter- oder häufiger noch falsch eingeschätzt wurde (und wird). Beides dürften Quellen der Motivation sein, insbesondere für den nicht-deutschsprechenden Teil der Luhmann-Anhänger. Die Mitglieder konnten zu Beginn also der motivierenden Auffassung sein, mit der Luhmann-Mailinglist am Gedeihen eines noch überaus zarten wie auch vielversprechenden Pflänzchens teilhaben zu können. Mittlerweile mag der Umgang mit Mailinglists abgeklärter sein, das Medium hat von seiner Faszination vermutlich eingebüßt, aber zu einem beträchtlichen Teil erkläre ich mir aus dieser Motivation heraus den Unterschied, warum 34.5% der Befragten der ML-Luhmann, aber nur 26.8% der Befragten der ML-Soziologie eine Bindung oder gewisse Verantwortung für das Gelingen der Kommunikation mittels dieser Mailinglist empfinden (vgl. Fragebogen Frage V53).
Besonders dazu beigetragen, die ML-Luhmann als eine anspruchsvolle Diskursplattform zu entwickeln, hat aber vermutlich das Auftreten von Peter Fuchs, einem der wichtigsten systemtheoretischen Soziologen Deutschlands, der der Liste im Februar 1996 beitrat. Zwar waren auch vorher schon einige bekannte Systemtheoretiker vertreten, doch kommentierten diese bei weitem nicht in dem Ausmaße wie Peter Fuchs. Inzwischen hat sich ein bemerkenswert großer Anteil der bekannten deutschsprachigen Systemtheoretiker-Szene in die ML-Luhmann eingeschrieben.(Endnote 19)
Der ML-Soziologie fehlt es dagegen an einem solch attraktiven, aktiv diskursanheizenden Personal. Generell scheint es außerhalb der Systemtheorie und der empirischen Sozialforschung in der Soziologie seit Jahren schon kein Bedarf nach Diskursen zu geben. Statt aktiv zu debattieren, erinnert man sich lieber an grosse Debatten. Es gilt aber auch bei der Erklärung, den Interaktionseffekt zwischen den Listen zu berücksichtigen. Wie bereits oben festgestellt, haben sich 20.1% der Mitglieder der ML-Soziologie auch in die ML-Luhmann eingeschrieben, so dass man annehmen darf, dass diese bei theoretischen Ambitionen sich eher der ML-Luhmann als der ML-Soziologie zuwenden.
6.3.4 Threads
Von Threads spricht man, wenn Mailinglist-Beiträge thematisch explizit aufeinander Bezug nehmen. Ein solch explizit ausgewiesener Bezug von Beiträgen läßt sich formal an der Übernahme der Subject-Zeile, mit einem vorangestellten "Re:" oder "Fwd:", sowie darüberhinaus anhand der Übernahme besonders charakteristischer Textbestandteile ablesen, die im Text typischerweise durch ein ">" in der ersten Spalte einer Zeile gekennzeichnet sind. Bei derart gekennzeichneten Passagen handelt es sich um Zitate aus vorigen Beiträgen. Zitate werden im Netzjargon als "Quotes" bezeichnet.
Zunächst zum Quotes-Anteil der Beiträge. Der aktuelle, über den gesamten Zeitraum gemittelte Quotes-Anteil der drei Mailinglists liegt in der ML-Soziologie bei etwa 20%, in der ML-Luhmann bei etwa 17%, in der ML-IMD bei etwa 15%. Der Tendenz nach läuft der Anteil auf einen Wert um 20% zu. Offenbar ist die redundante Aufnahme eines vorigen Beitrages in der Größenordnung von einem Fünftel optimal für den Anschluß eines neuen Beitrags. In einem sehr viel geringeren Umfange als 20% könnte ein Quoteanteil, aus der Sicht des Lesers, womöglich Zweifel an der angemessenen Berücksichtigung des vorigen Beitrags aufkommen. Ein Quoteanteil in einem sehr viel größeren Ausmaße könnte wiederum Zweifel an der Eigenständigkeit und thematischen Variationsfähigkeit des neuen Beitrags entstehen lassen.
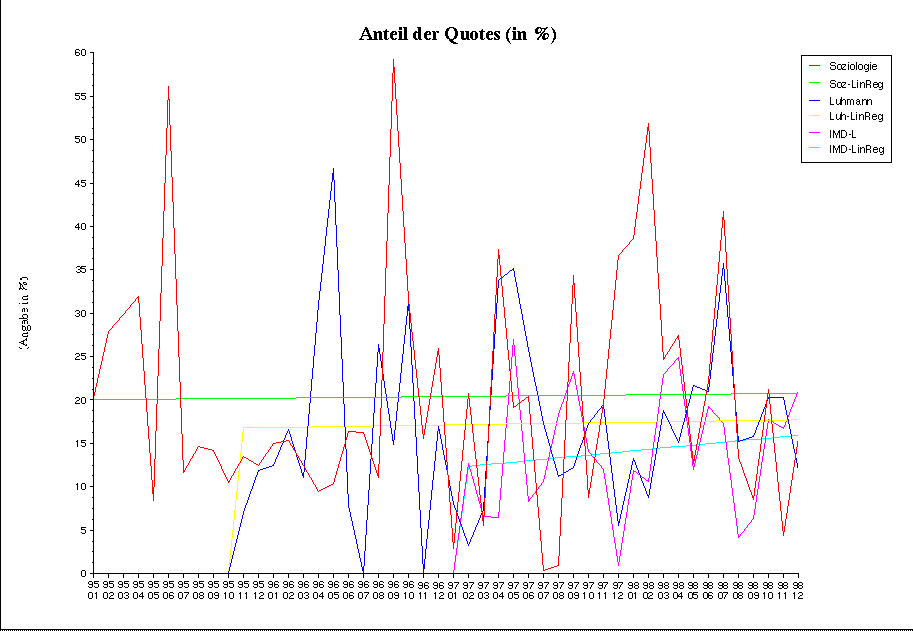
Die Anzahl der Threads in den Mailinglists laufen dagegen nicht auf einen derart fixen Wert zu. In der ML-Soziologie nahm die Zahl der Threads ab, in der ML-Luhmann nahm die Zahl der Threads in einem größeren Ausmaße zu. Während die ML-Soziologie im ersten Jahr ihres Bestehens mit etwa 20 Threads pro Quartal(Endnote 20) startete, wies die ML-Luhmann in ihrem ersten Jahr nur rund 5 Threads pro Quartal aus. Thread-Spitzen finden sich überwiegend im 1. Quartal eines Jahres, relativ wenige Diskussionen finden im 3. Quartal statt. Der einsame Spitzenwert mit 65 Threads war im 1. Quartal 1998 in der ML-Luhmann zu verzeichnen.
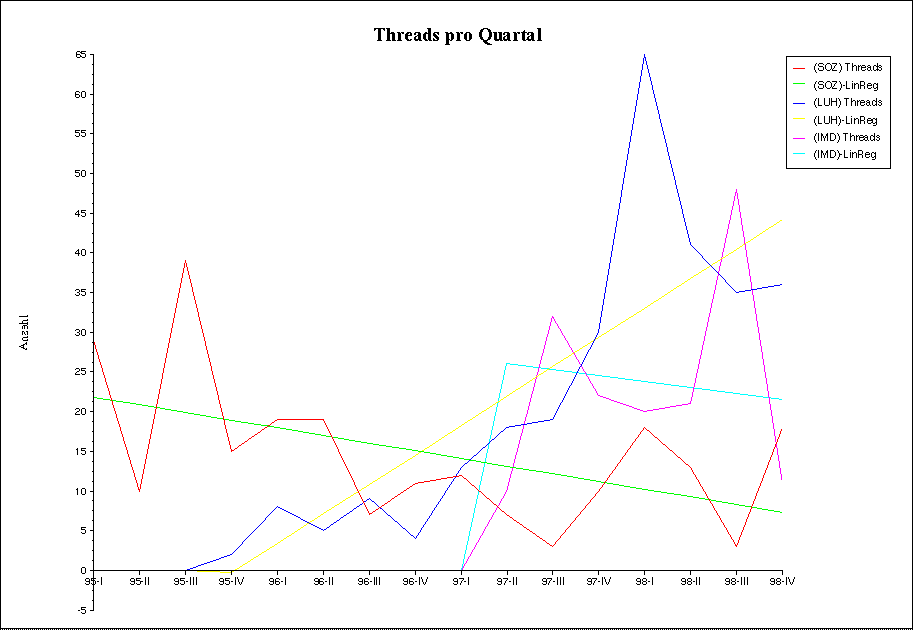
Dieser Befund bestätigt insofern noch einmal die Charakterisierung der beiden Listen: Die ML-Luhmann ist primär eine Diskussionliste, die ML-Soziologie eher eine Serviceliste.
Daran schließt sich die Frage an, wie viele Artikel durchschnittlich ein Thread enthält und ob sich hier wie beim Quoteanteil von 20% ebenfalls ein stabiler durchschnittlicher Wert andeutet. Ein solcher Trend zu einem solchen Wert scheint bei den drei Mailinglists tatsächlich vorzuliegen. In der ML-Luhman umfaßt ein Thread schon über Jahre hinweg stabil fünf Artikel, in der ML-Soziologie lag dieser über Jahre hinweg eher bei vier Artikeln, der durch einen extremen Ausreißer zum Ende der Beobachtungszeit zu einer Progression und einem Mittel von fünf Artikeln pro Thread führte. Die Tendenz zu fünf Artikeln pro Thread wird auch von den Threads der IMD-L bestätigt.
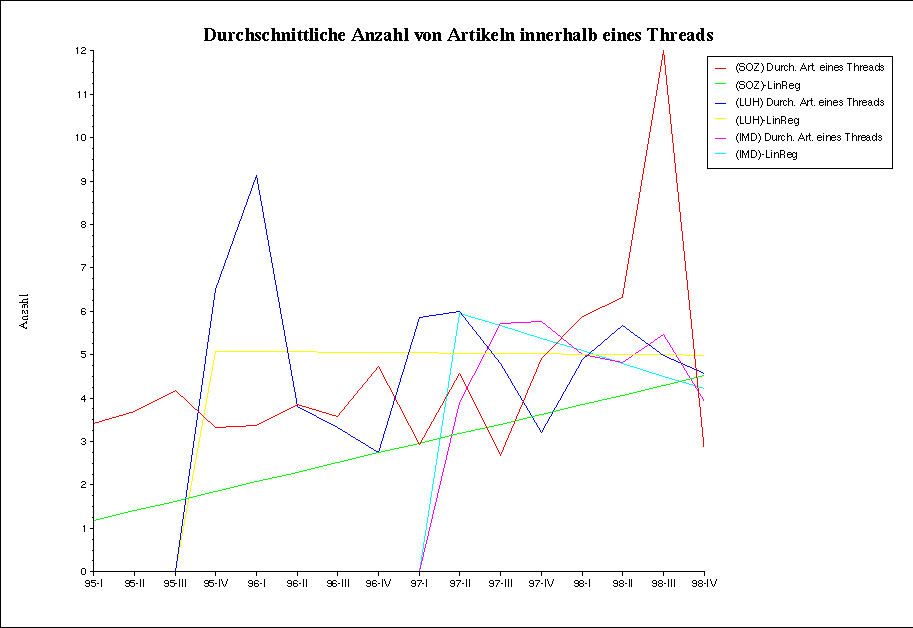
Neben der durchschnittlichen Anzahl der Beiträge ist auch der Aspekt der durchschnittlichen Dauer von Threads interessant. Die Schwankungen sind beträchtlich, im Durchschnitt dauern Threads jedoch in allen drei Listen sechs Tage.(Endnote 21)
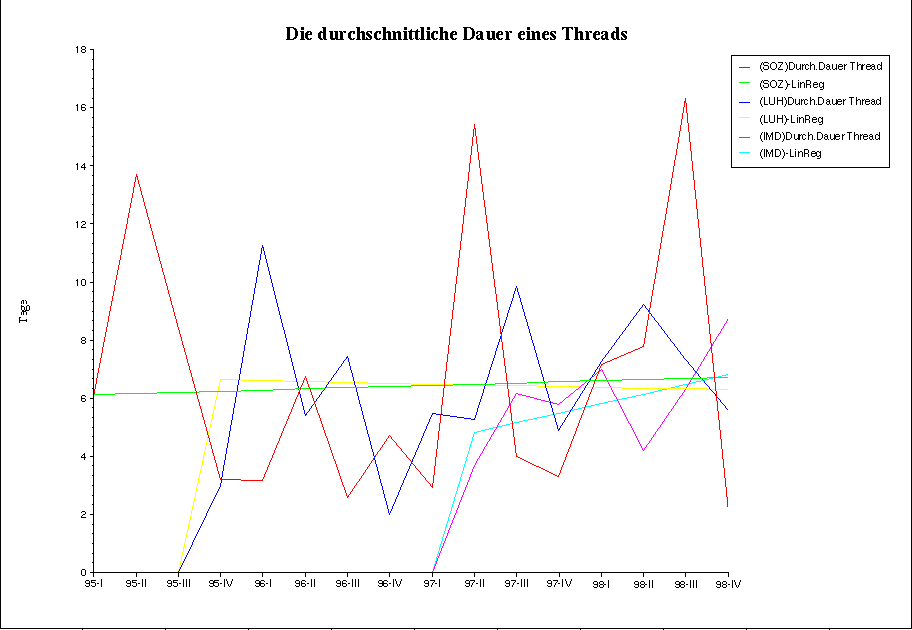
Ferner war von Interesse, wie hoch der Anteil derjenigen Threads ist, die besonders viele Beiträge enthalten. Als besonders lang anhaltend lassen sich solche Threads bezeichnen, die mindestens das Doppelte der durchschnittlichen Beitragszahl enthalten, also mindestens zehn Beiträge pro Thread. Der Anteil solcher Großthreads liegt, gemessen am Gesamtaufkommen gemittelt über die drei Mailinglists, bei ca. 8%.
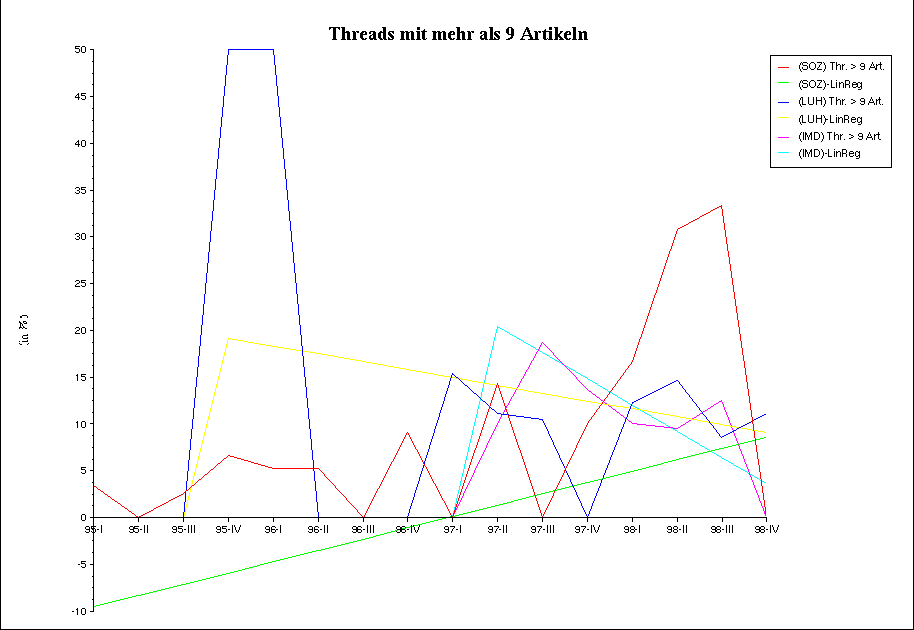
Als besonders dauerhaft bezeichne ich solche Threads, die wiederum mindestens das Doppelte einer durchschnittlichen Threaddauer, in diesem Fall also länger als 13 Tage, andauern. Diese machen einen Anteil von 12% aus.
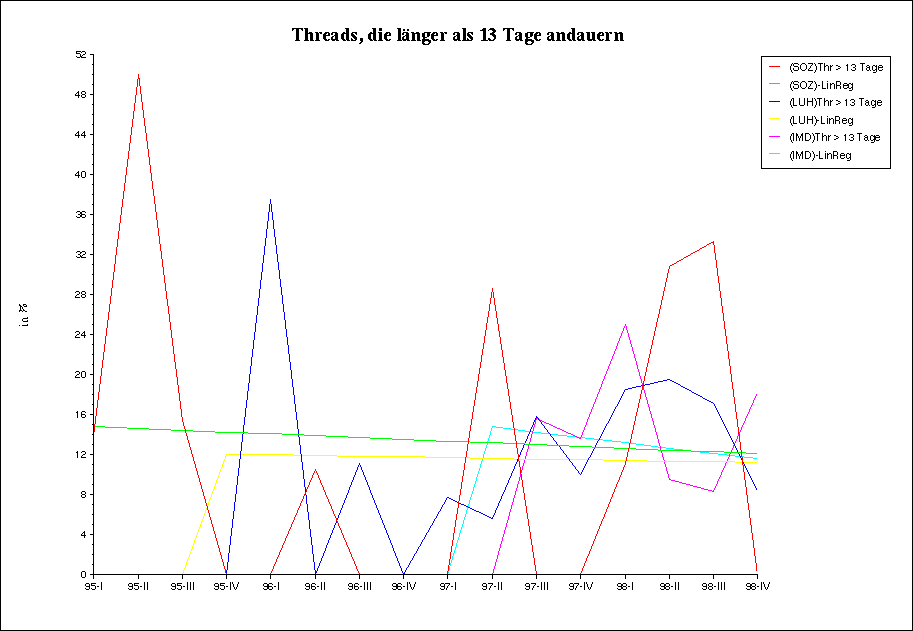
Desweiteren stellte sich die Frage, in welchem Verhältnis Artikel und Threads stehen und ob sich hier vielleicht ein Wert abzeichnet, wonach eine stabile Anzahl von Artikeln Bestandteile von Threads sind. Den berechneten Wert - Anzahl der Threads pro Quartal multipliziert mit der durchschnittlichen Anzahl der Artikel pro Thread dividiert durch die Gesamtzahl der Artikel - begreife ich als ein Maß für die Diskursintensität einer Mailinglist.
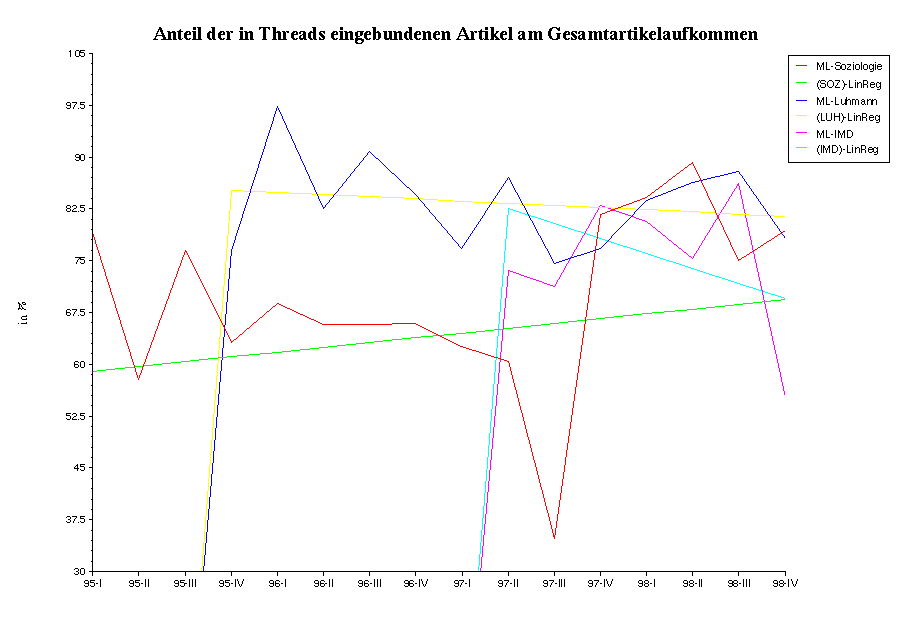
Etwas überraschend nimmt in der ML-Soziologie der Anteil der in Threads eingebundenen Artikel gegenüber den singulär bleibenden Artikeln tendentiell leicht zu, allerdings bei einem Startwert von nur knapp 60%. In der ML-Luhmann nimmt der in Threads eingebundene Anteil von Artikeln ganz leicht ab, allerdings bewegt sich dieser Anteil, das ist nicht überraschend, auf einem ungleich höheren Niveau mit einem Startwert von etwa 85%. Die Bandbreite des Anteils der Thread-Artikel in der ML-Luhmann bewegt sich zwischen 75% und 97.5%(Endnote 22) , und ist somit homogener im Vergleich zur ML-Soziologie, deren Bandbreite zwischen 35% und 90% liegt. In der Gesamttendenz scheint sich in der ML-IMD ein Wert für die Diskursintensität von 75%, in der ML-Soziologie von um die 70% abzuzeichnen, in der ML-Luhmann sind es um die 80%. Die Gesamtbandbreite der Diskursintensität der drei untersuchten Listen beträgt somit zwischen 70% und 80%, womit offenbar ein gewisses Stabilitätsniveau für die Diskursintensität von Mailinglists gekennzeichnet ist. In der ML-Luhmann hat ein Teilnehmer also beste Chancen, dass sein Beitrag kommentiert oder seine Frage beantwortet wird, denn nur jeder 5. Artikel bleibt ohne Folgeartikel. Und die ML-Soziologie ist demnach keine reine Service-Mailingliste mit Verlautbarungen und Ankündigungen, die die Mitglieder schlicht zur Kenntnis nehmen können und die in der Regel keine weiteren Kommentare anstoßen. Allerdings weist die große Bandbreite der Diskursintensität der ML-Soziologie auf ein gewisses Maß an Unberechenbarkeit hin.
Faßt man die Ergebnisse zusammen, so zeigt sich, dass die Entwicklung einer stringenten, gehaltvollen Diskussion in Mailinglists dann am ehesten zustande kommt, wenn nur eine relativ geringe Zahl an Teilnehmern cokonstruktiv, also mit negativen und positiven Bezugnahmen, debattiert. Deren Beiträge müssen so verfaßt sein, dass sich nicht jedes Mitglied aufgefordert sieht, selbst einen Folgebeitrag anzufertigen. Dies gelingt am besten sowohl durch besonders konturiert-schwierige als auch besonders strukturarm-leichte Beiträge, weil diese entweder aus Über- oder Unterforderung keine angemessene kommunikative Autoren-Identität durch einen Folgebeitrag auszubilden gestatten und dadurch einen vergleichsweise geringeren Sog auf Nachfolgeartikel ausüben. Für das Gelingen von diskursiv ausgerichteter Mailinglistkommunikation ist insofern sowohl die gut strukturierte Teilnahme wie auch das Schweigen einer großen Zahl an Teilnehmern Voraussetzung. Es entwickeln sich Formen der Diskursermutigung (typisch durch Provokation) wie Diskursentmutigung (etwa indem angekündigt wird, dass keine weitere Replik folgen wird). Insbesondere den Schweigern, die im Netzjargon abfällig als "Lurker" (Lauernde, Schleicher) bezeichnet werden, fällt demnach eine wichtige Funktion zu, wie Stegbauer und Rausch zeigen (Stegbauer/ Rausch 1999: 107).
Neben der Unterscheidung von Lurkern und Autoren bilden sich innerhalb der Gruppe der Schreibenden einige weitere Rollen aus. Stegbauer/ Rausch unterscheiden sieben Blöcke unterschiedlicher kommunikativer Beziehungen von Teilnehmern. Neben wenigen Meinungsführern (vgl. Wetzstein/ Dahm 1996; Döring 1997), die sich sehr stark beteiligen, zeichnet sich eine Gruppe an Mailinglist-Teilnehmern beispielsweise durch das Beantworten von Anfragen aus, zwei andere Gruppen beteiligten sich überproportional an Diskussionen. Insbesondere Lurker, die die Liste schon länger beobachten, werden dadurch zum Schweigen ermutigt, wenn die Rollen "Beantworter" oder "Diskutant" in der Mailinglist hinreichend verläßlich - d.h. innerhalb einer noch näher zu spezifizierenden Zeitspanne, auftreten.
Endnoten
Endnote 1: Vermutlich lag damals der Anteil an Studenten noch etwas höher, da die Befragung in die Semesterferien gefallen war. - zurück -
Endnote 2: Die Daten der IMD-Liste sind nicht berücksichtigt, weil das Datenmaterial der Mitgliederlisten zu lückenhaft ist. - zurück -
Endnote 3: Anmerkung: Wenn man die absolute Anzahl der Statusangaben addiert, ist das Ergebnis größer als die Anzahl der abgegebenen Fragebögen. Dies liegt daran, dass einige der befragten Mitglieder (ML-Soziologie: 4, ML-Luhmann: 5) mit Bezug zur Soziologie über unterschiedliche akademischen Status verfügen. - zurück -
Endnote 4: Diese Vermutung wird sich im Fortgang dieser Untersuchung verdichten. - zurück -
Endnote 5: Man denke allein an die gegenüber Atari-TOS, MacOS oder DOS/Win3.1 ungleich komplizierter anmutende Bedienung der damalig vorherrschenden VMS- oder Unix-Rechner an den Rechenzentren, an denen man über Textterminals verbunden arbeitete. - zurück -
Endnote 6: Gegen Word als Quasi-Textverarbeitungsstandard wehren sich eine ganze Reihe an Textverarbeitern ganz bewußt, weil Word (und andere Textverarbeitungen) im Vergleich zu entwickelteren Formen der Textverarbeitung (vornehmlich solche, in denen Markup-Languages benutzt werden) zu viele konzeptionelle Mängel aufweisen - vom Einschleppen von Makroviren noch ganz abgesehen. Diese Mängel betreffen vor allem die Orientierung am Primat des Layouts auf Papier und sind dadurch insbesondere für eine technisch vernetzte Zusammenarbeit als untauglich einzustufen (vgl. Recke 1997). Statt in einem neuen Medium die neuen Möglichkeiten zu nutzen, bilden Textverarbeitungen nur alte, operativ-passive Formen des Papiers im neuen, nunmehr auch operativ zugänglichen Digitalmedium ab. - zurück -
Endnote 7: Und auch der Papierverbrauch steigt
weiterhin:
"Das Internet erhöht den Papierverbrauch - Rund 18
Prozent der deutschen Bevölkerung verbraucht durch die Nutzung
des Internet deutlich mehr Papier als zuvor. So lautet das Ergebnis
einer repräsentativen Umfrage, die das Meinungsforschungsinstitut
Ipsos im Auftrag von Minolta durchgeführt hat. Insbesondere
E-Mails mögen die Deutschen lieber in gedruckter Form: Nur 6,8
Prozent der Nutzer lesen ihre elektronischen Nachrichten
ausschliesslich am Bildschirm. Diese Zahlen belegen, dass der
papierlose Arbeitsplatz noch lange nicht in Sicht ist. Entsprechende
Studien in den USA erbrachten ähnliche Resultate." (Heise
Newsticker vom 27.07.2000)
- zurück -
Endnote 8: Insofern führt hier die Leichtigkeit der Teilhabe am Kommunikationsgeschehen, die gemeinhin als eine Stärke elektronischer Foren ausgewiesen wird, in Situationen des Überangebots an Texten zugleich zur Regression auf einen stärker autor- statt textzentrierten Auswahlmodus. Dadurch entsteht eine bemerkenswerte Schieflage: Auf der einen Seite findet eine Entsubjektivierung der Texterstellung statt, wenn man an Mailinglist-Diskurse denkt, in denen kein Teilnehmer den Gesamttext, oder auch nur eine bestimmte Idee darin, sofern sie aufgegriffen und fortgesetzt wird, sich selbst zurechnen darf. Auf der anderen Seite werden unter entwickelten Bedingungen der elektronisch gestützen Kommunikationen Beiträge anhand von Autorennamen ausgewählt. Der Ausweg aus dieser Schieflage könnte auf Seiten der Rezeption von Beiträgen eines Tages darin bestehen, eine maschinelle Vorverarbeitung von Texten zu nutzen, so dass ein Zugriff auf Texte auch anhand maschinell erstellter Textanalysen möglich würde. - zurück -
Endnote 9: Der Mailinglistowner der Liste weist mindestens einmal im Monat in seinen offiziellen Mitteilungen in seiner Signature darauf hin, auf welche Weise ein Hilfetext zum Umgang mit der Mailinglist sowie die Beiträge aus der Vergangenheit bezogen werden können - zurück -
Endnote 10: Es traf eine E-Mail mit der Nachfrage ein, welcher Unterschied zwischen Dogmatismus und Orthodoxie bestünde. Der Unterschied läßt sich in zeitgenössischer Perspektive wie folgt markieren: Dogmatisch bedeutet, dass sich etwas im Grundsatz nicht in Frage stellen läßt. Orthodox bedeutet dagegen, etwas im Rahmen einer eingefahrenen Linie zu behandeln, ohne dass dabei Wert auf Kreativität und Einfallsreichtum gelegt wird. - zurück -
Endnote 11: Diesen Mailinglists gemeinsam ist, dass sie thematisch allesamt um Kybernetik, Systemtheorie oder Autopoiesis kreisen. - zurück -
Endnote 12: Die ML-Luhmann weist 1.49 Artikel am Tag aus Tabelle). - zurück -
Endnote 13: Die konsistente Unterscheidung in Autoren und Teilnehmer läßt sich, so wie es zu wünschen wäre, hier nicht mehr vornehmen, weil der Sinn einer solchen Unterscheidung erst zum Ende der Untersuchung klar wurde. Deshalb werden im Text Autoren und Teilnehmer gleichgesetzt. - zurück -
Endnote 14: Präziser: Die Autorin wurde von der Verwaltung der ML-IMD wegen anhaltender Beleidigungen anderer Teilnehmer ausgeschlossen, der Autor verließ die ML-Luhmann freiwillig. Der formal problematische Ausschluß der Autorin hatte noch ganz interessante Folgen. Fünf Monate später hatte sich diese Mailinglist ein Abstimmungsverfahren gegeben, um zukünftig in der Lage zu sein, in Konflikten demokratisch legitimierte Entscheidungen treffen zu können (RfD_CfV-Abstimmungsverfahren). - zurück -
Endnote 15: Mittlerweile hat es sich durchgesetzt, dass nicht-diskursiv-angelegte Artikel ebenso wie Fragebögen entweder im World-Wide-Web veröffentlicht oder per E-Mail direkt den Interessenten zugestellt werden. - zurück -
Endnote 16: Sofern in einem Artikel mehrere dieser Themen angesprochen wurden, wurde ein Artikel entsprechend mehrfach kodiert. - zurück -
Endnote 17: Anmerkung: Die 0% fehladressierten Mails (Code: E) rühren daher, dass die Zahlenangaben gerundet wurden. Etwa vier von 1000 über die Mailinglists geschickte Mails sind fehladressierte Mails (wie beispielsweise ein UNSUBSCRIBE-Befehl, der an die Mitglieder und nicht an den Server adressiert ist). - zurück -
Endnote 18: Das Löschen einer E-Mailadresse aus der Mitgliederliste einer Mailinglist ist natürlich ein Politikum ersten Ranges. Deshalb halte ich es als Administrator ("Mailinglistowner") so, dass die Adressen auf der Mailinglist veröffentlicht werden, damit zumindest eine kleine Chance für die Betroffenen besteht, die über E-Mail nicht mehr zu erreichen sind, über andere Wege von der Löschung zu erfahren. - zurück -
Endnote 19: Auf die sich seit längerem schon abzeichnenden Differenzierungen innerhalb der Systemtheorie muss hier nicht eingegangen werden. In den meisten engagierten Initiativbeiträgen wird der Bezug zur originellen Seite Luhmanns hergestellt. - zurück -
Endnote 20: 1. Quartal: Januar bis März, 2. Quartal: April bis Juni, 3. Quartal: Juli bis September, 4. Quartal: Oktober bis Dezember - zurück -
Endnote 21: Leider wurde versäumt zu ermitteln, in welchem zeitlichen Abstand die erste Reaktion auf einen Initiativbeitrag erfolgte, um so etwas wie eine durchschnittliche Antwortzeit einer Mailinglist angeben zu können. - zurück -
Endnote 22: 97.5% bedeutete, dass auf nahezu jeden Artikel ein bezugnehmender Artikel folgt. - zurück -
7 Kennzeichen einer gut funktionierenden Mailinglist
|
Statt eines Fazits möchte ich zum Schluß die wichtigsten Merkmale einer erfolgreich operierenden, akademisch orientierten Mailinglist zusammenstellen:
8 Literatur
|